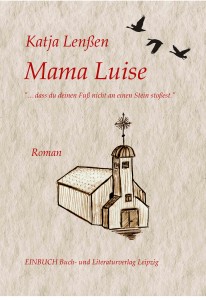Verfilzte Welt: Frank Freyer erkundet die Wendungen und Verwirrungen in seinem Leben im verfitzten deutschen Osten

Der I.C.H. Verlag ist im Grunde der Bruder des Leipziger Einbuch-Buchverlages, der deshalb so heißt, weil er sich vorrangig autobiografischen Schriften widmet. Und weil es hier nicht um Bestseller-Status geht, veröffentlichen hier auch Autor/-innen ihre Lebensgeschichten, die nicht ins dominierende Raster passen. So wie Frank Freyer, der sich durchaus fragt, wie es zur Rumpeltour im eigenen Leben kommen konnte.
Denn nicht an allem sind die Mächtigen schuld. Und wer behauptet, in seinem Leben immer schon gewusst zu haben, wie die große Geschichte läuft, der lügt. Der lügt sich auch selbst in die Tasche. Misstraut den großen Biografien, könnte man sagen. Sie verkaufen einem lauter Leute, die sich für die Macher ihres eigenen Lebens ausgeben und alles weglassen, was der ganz gewöhnliche Erdenbürger ständig erlebt: Unsicherheit, Glück, Zufall, Fügung, Schwein, Opportunismus, falsche Entscheidungen, Reue, Zweifel, blaue Flecken usw.Das wird in westlichen Landesteilen nicht anders sein als in östlichen, nur müssen die Bewohner jenes Landstücks, auf dem mal die DDR existierte, mit deutlich mehr Brüchen umgehen. Und die meisten, wirklich die meisten müssen damit leben, dass sie bis zum 9. Oktober oder 9. November 1989 ganz und gar nicht im Dissens mit diesem Land gelebt haben.
Manche saßen tatsächlich am 9. Oktober behelmt und gerüstet in Bereitschaft und wussten schlicht nicht, wie ihnen geschah. Andere verwandelten sich schwups im Februar 1990 aus emsigen Mitläufern in immer schon gewesene Widerstandskämpfer. Und manche erwischten die Ereignisse des Herbstes mitten im Dienst, so wie auch Frank Freyer, der in diesem Büchlein versucht zu ergründen, warum er an einigen Stellen in seinem Leben nicht den Mut aufbrachte, sich zu verweigern.
Denn dass er – als schüchterner Mensch – eigentlich völlig falsch war, als er sich zu 25 Jahren Offiziersdienst in der NVA verpflichtete, das wusste er eigentlich schon vorher. Selbst sein Cousin sagte es ihm. Und als er nach 13 Jahren in Uniform, die ihm ganz augenscheinlich auch eine Menge psychische Probleme einbrachten, 1990 seinen Abschied nahm, schied er ganz und gar nicht mit Wehmut, gehört also ganz offensichtlich nicht zu den einstigen NVA-Offizieren, die diese Niederlage gegen den „Systemfeind“ nie verkrafteten und sich in entsprechenden Vereinen versammelten, um ihrem Traum vom Sozialismus nachzutrauern.
Freyer beleuchtet also mit seiner Lebenserkundung einen Teil der einstigen DDR-Gesellschaft, der für gewöhnlich in den meisten Betrachtungen zu diesen 40 Jahren DDR nie vorkommt. Denn es ist natürlich immer billig, die Welt einfach in Gut und Böse zu teilen, in Diktatur und Widerstand, in Sieger und Unbelehrbare.
Aber was ist eigentlich mit all denen, die im System DDR irgendwie versuchten, richtige Entscheidungen zu treffen und dann trotzdem merkten, dass es die falschen waren? Und die dann auch noch – wie Freyer – den Stolz hatten, nicht von der Fahne zu gehen und lieber die Zähne zusammenbissen und die Arschbacken zusammenkniffen, um zu ihrem Versprechen zu stehen?
In diesem Fall also durchaus zur eigenen Not, auch weil er seinen Vater nicht enttäuschen wollte und weil die Offizierslaufbahn in der DDR prestigeträchtig war, auch wenn er am Ende von massiven Anfeindungen durch Zivilisten gegen uniformierte Offiziere in Berlin berichtet. Aber ab 1985 war ja auch für ihn unübersehbar, dass sich der Wind drehte und im Osten durch Gorbatschow so ziemlich alles in Bewegung geriet. Da waren die Versuche der „Betonköpfe“ in Ostberlin, sich gegen jede Veränderung zu verwahren, schon unübersehbar.
Glück für Freyer: Aus dem Dienst bei der Truppe – also einer Infanterieeinheit mit durchaus renitenten Soldaten – wurde er von seinen Vorgesetzten schon bald entbunden und als Ausbilder abkommandiert. Dass die Wehrpflichtigen im stolzen Arbeiter- und Bauernstaat ganz und gar nicht freiwillig und gutgelaunt zum „Ehrendienst“ antraten, hatte er also selbst erlebt – und auch, was die Untergebenen mit einem Leutnant anstellen konnten, den sie als weich und sensibel erkannten.
Wie viele junge Menschen haben eigentlich in der DDR so eine falsche Entscheidung für sich getroffen, nur weil sie damit ein sicheres Einkommen und eine planbare Lebensperspektive bekamen? Und was wurde aus ihnen? Denn Fakt ist ja auch, dass die Hardliner und Betonköpfe in der Minderheit waren. Die meisten standen 1990 vor der alten, unsicheren Frage: Was nun? Und nicht alle scheiterten in der neuen Gesellschaft, die durchaus Bedarf hatte an Akademikern und Leuten mit Führungspraxis.
Die wurden nicht allesamt Versicherungsvertreter. Manche ergriffen die Gelegenheit beim Schopf und wurden erst Buchhalter, dann Ausbilder an einer Umschulungsakademie wie Freyer, der die ersten Jahre nach 1990 so schildert, wie sie viele Ostdeutsche erlebt haben: als eine Zeit des Aufraffens, Bewerbungenschreibens, des Ausprobierens und der Zuversicht. Denn das, was er sich jetzt wagte, hatte er ja nicht gelernt, auch wenn er aus seiner Offizierszeit einen Titel als Ökonom tragen durfte. Aber Politische Ökonomie hat nun einmal wenig mit richtiger Betriebswirtschaft und Buchhaltung zu tun.
Aber gerade weil er sich traute und Dinge ausprobierte, die er vorher nie gemacht hatte, blickt Freyer gerade auf diese Zeit der immer neuen Anfänge nach 1990 mit Stolz zurück. Denn natürlich macht das stolz, wenn man sich selbst immer wieder beweist, dass man Neues lernen und beherrschen kann, wenn man sich nur auf den Hosenboden setzt und auch die Abende und Wochenenden dranhängt.
Und das haben die meisten Ostdeutschen gemacht. Auch das fehlt im Bild der deutsch-deutschen Missgunst, in dem der „Ossi“ für gewöhnlich als Daueralimentierter auf der Wartebank im Arbeitsamt sitzt, obwohl alle Zahlen gegen dieses Bild sprechen. Und auch wenn diese 1990er Jahre für die meisten Ostdeutschen letztlich eine Ochsentour waren, denn auf einigermaßen sichere Arbeitsplätze kamen auch alle die, die sich immer wieder neu aufrafften, meist erst zehn Jahre nach der „Wende“ oder noch später. Das Wort Arbeitskräftemangel gab es damals nicht, stellt Freyer fest.
Und wie sehr einen diese Neuorientierung in Anspruch nahm, macht er beiläufig am Thema Musik fest. Denn wirklich wieder einen freien Kopf für Musik hatte er erst 1995 wieder. Wobei Musik für ihn eigentlich ein Lebensthema war. Sie bestimmte seine Jugend in einer kleinen Stadt nahe Leipzig, wo er mit Gleichaltrigen und großer Kofferheule durch die Straßen zog und seine Lieblingsmusik laut aufdrehte – von CCR über Slade bis Nazareth.
Das muss, so stellt er nun in geruhsamerem Alter fest, für die damaligen Erwachsenen eine echte Zumutung gewesen sein. Andererseits faszinierte ihn aber auch die unerhörte Rockmusik des Ostens, die mit Honeckers Machtübernahme tatsächlich aufblühen konnte. Auch das kommt ja in vielen DDR-Geschichtsbetrachtungen nie vor, dass mit dem Neuen an der Spitze der SED auch so etwas wie Zuversicht im eingemauerten Ländchen aufkam, dass jetzt endlich mehr Freiheit einziehen würde. (Eine Hoffnung, die ja mit der Ausbürgerung von Wolf Biermann gründlich zu Ende ging.)
Von einigen der erstklassigen Bands, die in dieser Zeit auftauchten und Furore machten, zitiert Freyer auch die Liedtexte, die im Grunde alle Widersprüche des Lebens in der DDR enthielten. Auf einmal war das sagbar und wurde in poetischen Songs geradezu zur Lebensmusik einer ganzen Generation. Und für Freyer bündelte sich das alles in Heiner Carows Film „Die Legende von Paul und Paula“ mit der eindringlichen Musik der Puhdys, deren Songs „Geh zu ihr“ oder „Wenn ein Mensch lebt“ bis heute funktionieren.
Der Film stellte im Grunde alle Fragen, die sich Menschen in einem Land wie der DDR stellen mussten, wenn sie ihr Leben lebten und Entscheidungen trafen: Steht einer zu seiner Liebe, zu dem was ihm wirklich wichtig ist? Oder kneift er und lässt die Dinge laufen?
Das ist wieder so eine Stelle, an der einem der wirklich bekloppte Vorwurf aus der „Wende“-Zeit einfällt, der den Ostdeutschen immer wieder unter die Nase gehalten wurde mit dem – eigentlich falsch verstandenen – Adorno-Zitat „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“, dessen Fehlinterpretation eigentlich bis heute das Fremdbild der Ostdeutschen bestimmt.
Doch niemand hat sich die Frage nach dem richtigen Leben ernsthafter und eindringlicher gestellt als gerade die in der DDR Lebenden. Filme, Songs und Bücher erzählen davon – samt den damals tatsächlich stattfindenden großen Diskussionen, die teilweise sogar ins Parteiorgan ND hineinschwappten. Über „Paul und Paula“ wurde genauso intensiv diskutiert wie über „Guten Morgen, du Schöne“ oder Christa Wolfs „Kindheitsmuster“.
Muss man ja alles im Westen nicht wissen. Aber Freyer deutet zumindest an, wie wichtig das alles war. Und dass man 1977 dennoch den falschen Entschluss treffen konnte, sich für das halbe Leben bei der „Asche“ zu verpflichten, auch weil man vielleicht irgendwie glaubte, es diesem Land schuldig zu sein. Oder gar überzeugt war, dass die Bewerberkollektive, die in den Schulen unterwegs waren, doch im Kern recht hätten und das Land eine starke Armee brauchte, um den Sozialismus zu verteidigen.
Kann es sein, dass die DDR für doch gar nicht so wenige Menschen tatsächlich ein Projekt war, an das sie felsenfest glaubten? Eigentlich eine Frage, die irgendwann mal gestellt und untersucht werden sollte, bevor die Menschen alle gestorben sind und am Ende alle Ostdeutschen nur noch Widerstandskämpfer gewesen sind. Oder schreckliche Funktionäre im Dienst eines „Unrechtsstaates“.
Denn damit wird natürlich auch einer Menge Menschen, die das Versuchsprojekt im Osten für eine echte Alternative hielten, jede Legitimation abgesprochen. Und die DDR damit auch entkernt. Denn wer hat sie denn eigentlich getragen? Und wie gehen diese Menschen damit um, ihr Lebensprojekt derart sang- und klanglos scheitern zu sehen?
Das sind so Fragen, die eher beiläufig auftauchen, spätestens, wenn Freyer schreibt: „Dass die im Osten entstandenen kameradschaftlichen und solidarischen Beziehungen der Menschen untereinander bald dem Neid und der Missgunst im harten Alltag weichen würden, war mir bewusst. Da gab ich mich keinen Illusionen hin. Aber das positive Gefühl am Neuen überwog damals.“
Was ja auch andeutet, dass da mehr als nur sicher geglaubte Arbeitsplätze über den Jordan gingen. Da ging wirklich eine ganze Gesellschaft in die Binsen. Und gerade Ostdeutsche haben erlebt, dass eben mit der Deutschen Einheit gar nicht alles gut wurde. Und auch 30 Jahre nach der „Wende“ sieht auch Freyer ein vielfach zerrissenes Land, in dem auch die politischen Diskussionen nicht vereinen, sondern ausgrenzen und eskalieren, ohne dass die aufgestauten Probleme der Gegenwart gelöst werden.
Doch auch das konnte er ja lernen, dass der Westen ganz und gar nicht so entscheidungsfreudig ist, wie sein wirtschaftlicher Erfolg scheinbar vermuten lässt. Politische Entscheidungen werden nur zu gern erst nachholend, Fünf nach Zwölf getroffen. Zuletzt wird Freyer doch sehr nachdenklich, was die politische Gegenwart betrifft und die Unwilligkeit derer, die vom Aussitzen profitieren, auf ihr klimaschädliches Verhalten zu verzichten: „Aber die globalen Probleme dieser einen Welt pochen mittlerweile mit einem Vorschlaghammer an unsere Haustür. Und sie verlangen eine Lösung!“, schreibt Freyer.
Mit dem Ausrufezeichen endet sein Buch, das im Grunde ein Versuch ist, herauszufinden, warum sein Leben nach der scheinbar so klaren und eindeutigen Jugend auf einmal „verfilzt“ wurde, voller Entscheidungen, in denen auch Unsicherheit, Ratlosigkeit und Nachgiebigkeit steckt. Das Leben ist nicht so eindeutig, wie es viele Biografen behaupten. Und oft hängt alles an einem mutigen Ja oder mutigen Nein im richtigen Moment, oder an dem Mut, die Sache zu korrigieren. Ein Mut, den eher nicht die Meisten haben. Nur würden es die Meisten nie so nachdenklich auch zugeben, wie es Freyer hier tut.
Frank Freyer Sagt, was hat mir diese Welt verfilzt, als ich plötzlich erwachsen war?, I.C.H. Verlag, Leipzig 2020, 13,90 Euro.
Weltwärts, um die Enge der Heimat zu begreifen: Die Menschen kennenlernen, die hinterm Bretterzaun des weißen Hotelstrandes leben

Schadendorf: Weltwärts, um die Enge der Heimat zu begreifen. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserDie meisten Reisenden der Vor-Corona-Zeit haben eigentlich nichts von der Welt gesehen. Sie waren mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs, in betreuten Pauschalpaketen und in Urlaubsressorts. Aber mit der realen Welt der Menschen in den bereisten Ländern kamen sie kaum in Berührung. Auch das ist der Baustoff für Vorurteile. Deswegen sind die sechs Berichte von Kevin Riemer-Schadendorf auch eher keine Reiseerzählungen.
Eher etwas ganz Ähnliches, wie es Claudia Hildenbrandt und Daniel Mathias in ihrem Buch „Jesus liebt Radfahrer – Navid auch“ gemacht haben. Sie haben es Reisesplitter genannt. Von ihrer Radreise um die Welt haben sie lauter Begegnungen mit Menschen mitgebracht – gastfreundlichen, hilfreichen Menschen, die sich meist einfach gefreut haben, dass Menschen aus dem reichen Norden auch bei ihnen vorbeikamen – und zwar nicht im Touristenbus, sondern ganz ohne klimatisierte Distanz auf dem Rad. Das Verhältnis zur Welt ändert sich völlig, wenn man schutzlos unterwegs ist und die Hostels, Cafés, Garküchen und Krankenhäuser erlebt, wie sie für die Menschen abseits der Touristen-Hotspots Alltag sind.
Kevin Riemer-Schadendorf ist zwar nicht mit dem Rad gereist, hat sich aber – auch berufsbedingt – immer wieder auf solche Begegnungen eingelassen. In seinen sechs Geschichten erinnert er sich an das, was ihn besonders frappiert. Das Wort „beeindruckt“ mag man ja kaum noch verwenden, so plakativ ist es geworden. Als müsste die Welt nur aus lauter Sensationen bestehen. Aber die Realität in Ländern wie Ghana oder Togo ist nicht sensationell.
Schon gar nicht dort, wo Kevin Riemer-Schadendorf selbst bei seinen berufsbedingten Reisen von den üblichen Pfaden abweicht. Es ist nicht appetitlich, was hier hinter dem Bretterzaun zu sehen ist, der den Strand des Hotels von den benachbarten Hütten der armen Bevölkerung in Togo trennt. Es ist auch nicht appetitlich, was er nahe der Hauptstand von Ghana sieht und riecht, wo er eine Müllhalde besucht, auf der elektronischer Schrott aus Europa von den Einheimischen auseinandergenommen wird, um an die enthaltenen Metalle zu kommen.
Und auch das Erlebnis einer Malaria-Erkrankung nahe der ghanaischen Grenze wird keine Begegnung mit steriler Krankenhausgeborgenheit, wie man sie in Europa kennt. Aber die Geschichten sind auch keine Bloßstellungen, denn Scheu vor der Begegnung mit den Menschen, die dort leben, hat Kevin Riemer-Schadendorf nicht.
Er macht sich nicht zum europäischen Besserwisser, sondern versucht herauszubekommen, was vor Ort normal ist, lässt sich auch in Mama Lucies Hüttenrestaurant nahe Abidjan von ihr auftischen, was die Jungs am Nachbartisch, die gerade eine Fußballübertagung schauen, auch nehmen würden.
In Laos lässt er sich überreden, über den Mekong zur Grenzstation nach Kambodscha zu fahren, um dort dann nicht die berühmte Tempelanlage Angkor Wat zu besuchen, sondern das Minenmuseum von Aki Ra. Kambodscha ist – nach drei Bürgerkriegen – das Land mit den meisten vergrabenen Landminen. Und einige dieser besonders gefährlichen Sprengfallen kommen aus Deutschland. So, wie auch etlicher Elektronikschrott auf der Müllhalde bei Accra aus Deutschland kommt.
Jenem Deutschland, in dem bräsige Bürger mit Verachtung auf die Menschen herabschauen, die versuchen, aus den Bürgerkriegsländern des Nahen Ostens ins sichere Europa zu gelangen. Als Riemer-Schadendorf just im Jahr 2015, kurz nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, als die AfD mit 20,8 Prozent einen ihrer frühen Triumphe feierte, von seinem Vater den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag bekommt, doch einfach mal Urlaub in Bulgarien zu machen, sich kurzentschlossen ins Flugzeug setzt und nach Bulgarien fliegt, ist dieses seltsame Jahr wieder präsent.
Denn gerade wurde die sogenannte Balkan-Route dichtgemacht, die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Irak und Libyen sitzen in Bulgarien fest. Endstation. Eine bedrückende Endstation, wenn man weiß, wie sehr Europa sich seitdem – auch auf Druck der Bundesregierung – eingemauert und abgeschottet hat. Ganz nach dem alten Affen-Motto: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen.
Als ginge uns das alles da draußen nichts an und wäre Deutschland an nichts, was auf anderen Weltteilen die Menschen in Armut stürzt, schuld. Aber es sind europäische Fangflotten, die den afrikanischen Fischern die Lebensgrundlage rauben, weil sich die EU von den Ländern Afrikas die Fischfangrechte gekauft hat. Überall kommen auch die besonders geschätzten deutschen Waffen zum Einsatz, verdienen deutsche Konzerne mit.
Doch Corona hat dem blinden Pauschalreisen in die Welt erst einmal eine Grenze gesetzt. Vorzeitig, könnte man meinen, denn all die klimatischen Probleme, die der klimatisierte Massentourismus mit sich bringt, würden sich in den nächsten Jahren sowieso derart verschärfen, dass ein „exotisches Land“ nach dem anderen nicht mehr in der Lage gewesen wäre, die nötige Schein-Sicherheit zu geben. Auch nicht die, die darauf angewiesen sind, dass zahlkräftige Touristen ins Land kommen.
Gibt es den Urwald überhaupt noch, in dem Riemer-Schadendorf eigentlich eine große Fledermauspopulation erkunden wollte? Bekam Bulgarien eine Unterstützung aus Deutschland, um die Flüchtlinge menschenwürdig unterbringen zu können? Die fläzigen Wohlstandsbürger, die keine Scham mehr kennen, wenn sie über Türken und Araber reden, gibt es noch.
Sie treiben mit ihrer Ignoranz die Politik vor sich her. Nie im Leben werden sie sich als Rucksackreisende auf den Weg machen, um die von ihnen so verachteten Länder so zu bereisen wie die Einheimischen – in vollgestopften Bussen, auf Lkw-Ladeflächen, mit Übernachtungen in einfachen Hütten und immer auf die Hilfe und Ratschläge der dort Lebenden angewiesen.
Im Titel klingt es ein wenig an, als könne man so „die Heimat begreifen“. Aber das trifft es nicht ganz, auch wenn der Autor die Enge der Heimat betont. Wenn man so die Menschen anderswo wirklich kennengelernt hat,verlässt man tatsächlich den Wohlstandskokon, der auch unsere Vorstellungen über andere Menschen und Länder prägt. Die meisten deutschen Diskussionen verlassen diesen Kokon nie. Und so schauen wir Wohlstandsbürger voller Vorurteile und Besserwisserei auf die so fremde Welt, die wir am liebsten draußen lassen würden, in jenem Raum der ausgemalten Exotik, der uns unserer Verantwortung scheinbar enthebt.
Aber die anderen sind nicht schlechter und verantwortungsloser als wir. Sie leben mit anderen Zwängen, versuchen oft aus Müll noch ein tägliches Brot zu machen. Doch wir wissen fast nichts über sie und ihre Geschichte. In Laos wird es Riemer-Schadendorf so richtig bewusst. Auch so beginnt man, über Hilfsprojekte und Umweltschutz (anders) nachzudenken, hält sich nicht mehr vornehm zurück, weil man glaubt, alles sowieso besser zu wissen.
Denn es sind nicht die Kreuzfahrten, auf denen man lernt, wie eng verflochten alles ist in der Welt, sondern diese Reisen in die unkomfortablen Regionen am Rand, da, wo Menschen ihr Dasein in oft genug geschundenen Landschaften fristen und dem Reisenden dennoch freundlich und offen begegnen. Das erweitert tatsächlich den Horizont – nicht durch falsche Sightseeing-Erlebnisse, sondern durch die Begegnung mit richtigen Menschen in ihrem ungeschützten Alltag, oft an Orten, wo man schon glücklich ist, wenn es keinen neuen Bürgerkrieg gibt oder wenigstens ein paar Ärzte in der Nähe sind, die bei den schlimmsten Erkrankungen tatsächlich helfen können.
Kevin Riemer-Schadendorf Weltwärts, um die Enge der Heimat zu begreifen, I.C.H. Verlag, Leipzig 2020, 14,40 Euro.
Warum wir so außer uns sind und uns selbst nicht lieben können
Ich zu Ich: Von (un-)behüteten Elternhäusern, ADHS, Ritalin und einem irrelaufenden Bildungssystem

Michaela Rothe: Ich zu Ich. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserEs gibt Bücher, die sind eine Überraschung, auch wenn man beim Lesen des Waschzettels die Stirn runzelt: Wieder ein Buch über Glauben, Gott und die glückliche Rückkehr zur Religion? Aber was Michaela Rothe geschrieben hat, ist kein Zurück-in-die-Kirche-Buch. Und das Thema, das sich beim Lesen herauskristallisiert, entpuppt sich ganz und gar nicht als Glaube-Liebe-Hoffnung-Musik. Auch wenn es letztlich darum geht, da, wo wir uns fragen: Wer bin ich wirklich?
Aber wie kommt man dahin? Oder: Ist das überhaupt ein Problem? Wenn man so in den Medien verfolgt, womit sich Kirchen heute thematisch beschäftigen, merkt man schnell: Sie werden auch deshalb zunehmend irrelevant, weil sie zu den eigentlichen Problemen der Zeit nichts zu sagen haben. Als klaffe da ein riesiges Loch in der Wahrnehmung, woran die Menschen der westlichen Welt tatsächlich leiden, warum sie immer hektischer, trostloser, einsamer und – auch das gehört dazu – rücksichtsloser werden.
Und wer sich mit den Fragen wirklich beschäftigt, der stößt auf ein Tabu. Der stellt dann zwar – wie auch einige kluge Theologen immer häufiger – fest, dass immer mehr Menschen nach Spiritualität dürsten und sich ganz persönliche Wege zu ihrer ganz persönlichen Sinnfindung im Leben suchen. Gern mit geradezu exotischen religiösen Angeboten. Aber wo ist der Kern? Worum geht es eigentlich?
Das findet man nur heraus, wenn man anfängt zu stutzen. So, wie es Michaela Rothe schon früh erging, eigentlich seit dem Tag, als sie aus Tschechien nach Deutschland kam. Das war eine sehr heftige Begegnung mit der deutschen Bürokratie, auf die sie im Lauf ihres Buches noch öfter zu sprechen kommen wird.
Eine Bürokratie, deren Sinn es ist, Menschen zu bewerten und zu entwerten, zu sortieren und am wirklich Ankommen zu hindern (Stichwort Integration, die in Deutschland so oft und so falsch verstanden wird. Auch das findet man im Buch). Erst recht, wenn sie aus dem Ausland kommen.
Wer sich selbst nicht akzeptieren kann, akzeptiert auch die Nöte anderer Menschen nicht.
Michaela Rothe hat sich durchgekämpft. Sie hat sich nicht entmutigen lassen, sich lieber noch einmal auf die Schulbank gesetzt und die deutschen Abschlüsse nachgeholt. Und weil sie nicht nur nebenbei auch noch gejobbt hat (und damit die Arbeitswelten vieler Migranten kennenlernte, die in Deutschland versuchen, einen Fuß auf den Boden zu bekommen), sondern auch jede Chance nutzte, ein Praktikum zu machen, um in ihrem gewählten Beruf als (Sozial-)Pädagogin voranzukommen, wird ihr Buch (das sie wegen der schönen Ruhe auf einer Bank in der Kirche schreibt) zu einer lebendigen Reise durch jene Welt, in der die meisten von uns zu Hause sind.
Nicht nur die Armen und Geplagten. Nicht nur Menschen mit „Migrationshintergrund“. Nicht nur Schüler mit Integrationsschwierigkeiten, „Bildungsferne“, Obdachlose oder Behinderte.
Das ist der wohl größte Irrtum unserer Gesellschaft, dass all diese Ausgegrenzten und Verachteten nicht typisch sind für uns, nicht davon erzählen, wie unsere Gesellschaft tatsächlich funktioniert. Doch wer im Bildungsbereich landet, egal ob als Kindergärtner/-in, Therapeut/-in oder Lehrer/-in, der erfährt, wie die Maschine funktioniert, die schon ganz früh dafür sorgt, dass Kinder aussortiert werden, wie Lehrer zerrissen werden in dem Versuch, den Kindern die schablonierten Lernbausteine einzutrichtern und dabei in einem Affengalopp durch den Lehrplan hetzen, während all die Kinder, die das Höllentempo nicht mithalten können oder wollen, systematisch entmutigt, demotiviert und fortgeschickt werden.
Wir sind eine Gesellschaft des Wegschickens und Abschiebens. So, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, die wir kaltschnäuzig wieder nach Afghanistan, Libyen oder andere hoffnungslose Länder zurückschicken wie fehlgeleitete Amazon-Päckchen, so gehen wir auch mit unseren eigenen Kindern um.
Jeder Lehrer an Ober- und Förderschulen weiß das. Und jeder Arzt, der mit Kindern zu tun hat, die ADS, ADHS oder andere psychische Probleme aufweisen,weiß es. Und diese „Krankheiten“, die es früher wohl auch wirklich nicht gab, bekommen die Kinder in einem Bildungssystem, das niemanden bildet, aber junge Menschen frühzeitig zum tadellosen Funktionieren dressiert.
Und nicht nur die Schulen lernte Michaela Rothe von innen kennen (samt ihren frustrierten Arbeitskollegen, die alle Hoffnung längst haben fahren lassen, so, wie es bei Dante im „Inferno“ steht), sie hat sich auch nie gescheut, sich mit den ihr Anvertrauten tatsächlich zu beschäftigen. Ihr Buch ist gespickt mit Erinnerungen und Anekdoten, in denen sie davon erzählt, wie sich (junge) Menschen verwandeln, wenn sie merken, dass sich der Mensch vorn am Pult tatsächlich für sie, ihre Gedanken, Gefühle und Probleme interessiert.
Da denkt man ganz schnell an die eigene Schulzeit und welche Lehrer/-innen es tatsächlich waren, die einen bestärkt und ermutigt haben. Nicht nur zum Lernen. Sondern zum Herausfinden, wer man selbst ist. Denn die meisten wissen es nicht. Und haben auch nie die Chance bekommen, es herauszufinden. Denn das Drama unserer auf Funktionalität, Leistungserbringung und Karriere getrimmten Gesellschaft ist, dass alle Bürger von Anfang an eingetaktet werden in diesen immer mehr beschleunigten und forcierten Prozess. Schon Babys lernen zu funktionieren und nicht zu stören.
Und Eltern haben immer weniger Zeit, wirklich noch auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen, weil sie selbst in belastenden Jobs feststecken und abends fix und fertig nach Hause kommen. Und all die hübschen „Arbeitsmarktreformen“, die wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben (bis hin zu Schröders „Agenda 2010“) haben auf nichts anderes gezielt, als noch mehr billige Arbeitskräfte zu bekommen, die unter enormem psychischen Druck immer flexibler und mobiler bereitstehen, um das „Bruttosozialprodukt zu steigern“.
Aber was passiert eigentlich mit Menschen, denen früh schon beigebracht wird, dass nur ihr Funktionieren zählt? Dass sie keine Bedürfnisse haben sollen, dass sie die Klappe zu halten haben, nicht widersprechen dürfen und all ihre chaotische Lust am Lebendigsein bitteschön zu unterdrücken haben? So eine Gesellschaft wird kalt, einsam und rücksichtslos. Und diese Not, die immer mehr Menschen fühlen (auch die in den Umschulungskursen des Arbeitsamtes), tobt sich natürlich aus.
Bei den einen als Krankheit (denn wenn die Seele leidet, meldet sich der Körper mit Krankheiten zu Wort), bei anderen in Aggression. Dann wird dieses tiefsitzende Gefühl, nicht geliebt und akzeptiert zu werden, zum Hass gegen andere, denen es scheinbar bessergeht. So lassen sich Menschen, denen es allen gleichermaßen dreckig geht, gegeneinander aufhetzen.
Das schreibt Michaela Rothe so nicht. Denn eigentlich möchte sie von dem Weg erzählen, wie man da rauskommt. Und dieser Weg führt nun einmal über das eigene Ich. Das wir nur noch als Ego kennen in unserer Ego-Gesellschaft. Aber das Ego ist nicht das Ich. Psychologen wissen das, Hirnforscher inzwischen auch. Das Ego ist der schöne Schein, das, was wir nach außen zeigen, mit dem wir versuchen, den anderen den Erfolg und die persönliche Auserwähltheit zu suggerieren.
Denn davon lebt unsere Großkotzgesellschaft. An diese Egos kann sie ihre SUVs, Luxuswohnungen, Handtaschen, Sneakers, Smartphones und goldenen Armbanduhren verkaufen. An lauter arme Seelen, die versuchen, einander mit Protz und Schick zu beeindrucken. Oder lauter Pseudo-Bedürfnisse zu befriedigen, die nichts mit der inneren Not zu tun haben. Und schon gar nicht mit der eigenen Stärke.
Und hernach rennen alle zum Arzt und lassen sich Aufputschmittel und Beruhigungspillen verschreiben, um in dieser Hatz nach Status und Geld noch mithalten zu können.
Kein Wunder, dass Michaela Rothe Vertrauen und Hilfsbereitschaft fast ausschließlich bei den Menschen gefunden hat, die sich ganz unten in dieser Jobgesellschaft durchschlagen, die noch wissen, wie sehr man darauf angewiesen ist, dass man einander hilft.
Der Satz mit dem Glauben ist dann schon ein bisschen Fazit: „Wir haben den Glauben verloren. Wir glauben nicht mehr an Gott, an die Natur, an die kosmische Energie, an unsere Kinder, an andere Menschen. Die meisten von uns glauben nicht mehr an sich selbst.“
Die Reihe ist wichtig. Denn es geht um dieses Selbst, das die meisten schon früh verlieren, von sich abspalten müssen, weil sie so, wie sie sind, in diesem Rennen um Rekorde nicht akzeptiert werden. Sie lernen alle, dass sie immerfort zu funktionieren haben. Wer nicht funktioniert, ist raus. Der Druck, sich genau so zu verhalten, ist mittlerweile überall.
„Wir trennen uns von uns selbst und von der Menschheit. Wir vereinsamen. Aus der Angst heraus, allein zu sein, fangen wir an zu klammern, an Menschen, Titel, Status, Gegenstände, Geld, Eigentum, unseren Körper. Wir erstarren und werden immer unbeweglicher“, schreibt Michaela Rothe. Und dann folgt so ein Satz, der eine Menge von dem erklärt, was gerade in unserer politischen Schlammwüste geschieht: „Alles, was sich bewegt und erneuert, bedroht uns in unserer Existenz, macht uns Angst.“
Sie kommt ganz am Ende auch auf Jesus Christus, auch wenn sie den Spruch nicht direkt zitiert: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“
Ein Satz, der eben nicht nur die Nächstenliebe fordert. Sondern der auch davon ausgeht, dass jemand, der sich selbst nicht lieben kann, auch andere nicht lieben kann.
Aber Menschen, die von klein auf das Gefühl eingeimpft bekommen, dass sie den Erwartungen nicht genügen (und in dem Sinn praktizieren unsere Schulen bis heute Schwarze Pädagogik), die müssen ihr Selbst abnabeln, einmauern und verstecken. Sie dürfen sich nicht lieben. Denn sie sollen sich ja schämen, auf den Hosenboden setzen, entschuldigen, still sein, aufhören so lebendig zu sein wie sie sind. Deswegen gehören Selbstmorde, Sucht und Aggression zu den Grundbausteinen unserer Gesellschaft.
Denn Menschen, denen eingetrichtert wurde, dass sie nicht sie selbst sein dürfen, flüchten logischerweise in lauter Verhaltensweisen, die die Krankheit nach außen kehren. So, wie sie gegen ihr lebendiges Selbst kämpfen, wüten sie gegen die äußere Welt. Oder werden therapiert, wenn ihre unbeherrscht gewordene Unruhe die Ruhe stört.
So wie der angehende Lehrer, der der Autorin von seiner Ritalin-Erfahrung erzählt und dann sagt: „Das heißt, der Mensch kann alles lernen. Er wird so lange konditioniert, wie er sich zu verhalten hat, bis er sein Verhalten im Griff hat. Er hat seine Gefühle so verdrängt, dass er sie kaum mehr wahrnimmt. Er ist zu einem gefühllosen Zombie therapiert worden, kann sich aber benehmen. Bravo!“
Der Weg zu einem Leben ohne (Selbst-)Aggression führt also über das eigene Ich, zu den eigenen und wirklichen Gefühlen, dem, was uns wirklich berührt, betrifft und umtreibt. Das so zu Herzen geht, wie viele der von Michaela Rothe erzählten kleinen Begegnungen. Denn sie hat sich früh entschieden, von anderen Menschen lernen zu wollen. Auch und gerade von ihren Schülern.
Denn das hat sie schnell gemerkt: Dass die Arbeit als Lehrerin völlig sinnlos und ohne Erfolg ist, wenn die Lehrerin die Aufmerksamkeit und die Zuwendung ihrer Schüler/-innen nicht erweckt, nicht jenen Moment erreicht, an dem die Schüler/-innen sich verstanden und wahrgenommen fühlen. Da kann wirklich jeder an seine Schulzeit zurückdenken. Nur Lehrer/-innen, die das geschafft haben, die sich wirklich auf ihre Schüler eingelassen haben, bleiben auch positiv in Erinnerung.
Einfach schon deshalb, weil sie jedem Kind das Gefühl gegeben haben, dass es angenommen und akzeptiert wird. Und dass sie ihm etwas zutrauen. So, wie es ist. Und dass der Lehrplan eigentlich völlig egal ist, wenn die Kinder mit elementaren Problemen zu kämpfen haben und darüber endlich reden wollen. Das versuche mal einer im sächsischen Schulsystem – da rastet nicht nur der gepeinigte Lehrer aus.
Dass Michaela Rothe das Ganze dann nahe an den Bereich Glauben und Gott heranführt, hat mit dem zitierten Jesus-Spruch zu tun, den selbst Theologen gern halbieren und das „wie dich selbst“ wegoperieren, weil sie es nicht verstanden haben. Oder nicht verstehen wollen (dürfen). Auch nicht, dass unser Verbundensein mit dem Kosmos, der Natur oder eben wahlweise auch Gott in unserem Kopf sitzt.
Dass wir nicht vertrauen und nicht lieben können, wenn wir uns selbst nicht lieben können und nicht akzeptieren können als ein Geschöpf, das zu Leben und Lieben auf die Erde gekommen ist, und nicht dazu, ein Leben lang im Laufrad gefühlloser Maschinen zu rennen. Wer vergessen hat, dass sein Leben ein (kosmisches oder göttliches) Geschenk ist, der wird mit Angst, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit durch die Welt rasen, suchen, was nicht zu finden ist. Und wüten – gegen sich selbst und gegen andere.
Aber auch Michaela Rothe sieht Hoffnung, traut der jüngeren Generation zu, diesem teuflischen Kreislauf zu entkommen.
Denn wenn Menschen anfangen, ihre eigenen Gefühle, Ängste und Hoffnungen ernst zu nehmen und sich von verbitterten alten (weißen) Männern nicht mehr einreden lassen, dass sie falsch ticken, dann ändern sich die Spielregeln. Dann werden die wirklich wichtigen Themen sichtbar.
Und es stehen immer mehr Menschen auf der Straße, die wieder so ein Gefühl verspüren wie die Mutigen von Oktober 1989, die ja nicht demonstrierten, weil sie sich die D-Mark wünschten, sondern weil sie ohne Furcht und Einschüchterung ein menschliches Leben in einem freien Land leben wollten.
Aber bevor ich das Thema jetzt noch aufmache, empfehle ich einfach dieses Buch. Allen Erniedrigten und Verängstigten, Gejagten und Gepeinigten, Mutlosen und Sich-einsam-Fühlenden. Geht euer Ich suchen. Bevor es zu spät ist.
Wofür wir uns schämen: Ein Roman über Kindheitsmuster, falsche Rollen und den Mut zum eigenen Leben
Michaela Rothe Ich zu Ich, EINBUCH Verlag, Leipzig 2019, 16,40 Euro.
Maras Geschichte
Diagnose: Paranoide Schizophrenie – Wie eine Krankheit ein ganzes Leben aus den Angeln hebt
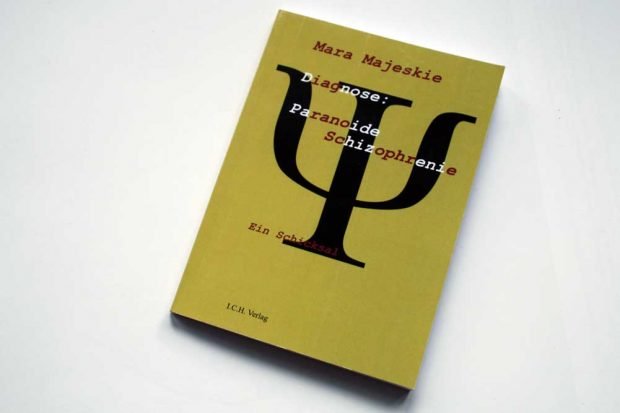
Mara Majeskie: Diagnose: Paranoide Schizophrenie. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserMara Majeskie ist ein Pseudonym. Verständlicherweise. Wenn es um Krankheiten, Behinderungen und das Nicht-so-Sein wie die anderen geht, dann beginnen in unserer Gesellschaft die Tabus und Aversionen. Sie liegen ganz dicht unter der Oberfläche. Denn mit den Nicht-Perfekten und Normierten kann unsere Eliten-Gesellschaft nichts anfangen. Da wird sie abweisend und verachtend. Und so schreibt Mara von sich auch lieber in der dritten Person.
Einerseits natürlich, um sich selbst zu schützen. Und natürlich auch, weil es auch dann schwer ist, mit einer Erkrankung wie der paranoiden Schizophrenie umzugehen,wenn man selbst betroffen ist. Denn sie greift in das Allerwichtigste ein, was einen als Person ausmacht: mitten ins Denken und ins Wahrnehmen der Welt.
Und auch die Hirnforscher wissen noch nicht wirklich, was da passiert, auch wenn sie inzwischen wissen, dass Schizophrenie mit chemischen Veränderungen im Gehirn einhergeht. Wikipedia fasst es kurz so zusammen: „Eine schizophrene Psychose geht auch einher mit biochemischen Veränderungen im Gehirn. Ebenfalls durch bildgebende Verfahren ist bekannt, dass bei Schizophrenie die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen im Gehirn bezüglich der Neurotransmitter-Systeme, die mit Dopamin, GABA, oder Glutamat arbeiten, von ihrer normalen Funktionsweise abweicht.“
Seit wir wissen, dass unser Denken – und damit auch unsere Weltwahrnehmung – auf chemischen Botenstoffen basiert, sind schizophrene Erkrankungen überhaupt erst einmal behandelbar. Von heilbar kann noch keine Rede sein. Aber gerade Schizophrenie macht ja besonders deutlich, wie sehr unser Ich tatsächlich Ergebnis der richtigen Signalübertragungen im Gehirn ist – und wie eine Störung dieser grundlegenden Funktionen dazu führt, dass sich die ganze Persönlichkeit verändert. Ursachen werden in der erblichen Vorbelastung gesucht. Aber Auslöser können diverse Stresseinwirkungen aus der Umwelt sein.
Und das kann, wenn diese Prozesse erst einmal ausgelöst werden, dazu führen, dass ein junger, kluger Mensch, der längst studiert und ein erfolgreiches Leben vor sich hat, völlig aus der Bahn geworfen wird. So erlebt es auch Mara, die mit ihrer hier aufgeschriebenen Geschichte versucht, ihren Weg in die Krankheit zu begreifen und gleichzeitig zu beschreiben, wie sie wenigstens wieder den Weg in ein einigermaßen selbstständiges Leben gefunden hat.
Was nicht geradlinig gelang. Denn natürlich ist das eigene Gehirn in so einer Phase kein kluger Ratgeber mehr. Es hat ja genug mit all den aus dem Lot geratenen Prozessen zu tun, mit Ängsten und Wahnvorstellungen. Und mittendrin das tapfere Ich, das doch eigentlich nur ein ganz normales Leben führen möchte, so wie alle anderen Menschen auch. Mit einer eigenen Wohnung, einer ganz normalen Erwerbstätigkeit, vielleicht einem Haustier …
Doch selbst die gewöhnlichsten Dinge werden kompliziert. Die Krankheit macht Mara immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Und ihre Versuche, die verordneten Medikamente abzusetzen, weil sie einige sehr unangenehme Nebenwirkungen haben, gehen eigentlich jedes Mal schief. Aber sie hat Glück – sie trifft auf Ärzte und Therapeuten, die verstehen, was die Krankheit anrichtet, auch wenn einzelne Medikamente immer nur einige chemische Prozesse wieder leidlich ins Gleichgewicht bringen können.
Mara wird wohl ihr Leben lang Medikamente einnehmen müssen, auch wenn die Hirnforschung möglicherweise irgendwann neue Ansätze findet, wie man all diese Prozesse im Gehirn regulieren kann, ohne dass die Patienten jeden Tag von ihren Medikamenten abhängig sind.
Das Buch ist keine Happy-End-Geschichte. Denn natürlich kann Mara einige ihrer Lebensträume, die sie noch als Schülerin für erfüllbar hielt, nicht leben. Damals beschäftigte sie sich schon mit dem Thema, ohne zu ahnen, dass es sie einmal selbst betreffen könnte.
Und natürlich auch nicht ahnend, wie sehr sie die Krankheitserfahrungen an die Grenzen des Aushaltbaren bringen würden. Denn die Veränderungen, die mit der Schizophrenie vor sich gehen, rühren an die allerelementarste Frage, die ja sogar Menschen in Ängste stürzen kann, die diese Krankheit nicht erfahren haben: Was eigentlich ist Realität?
Was gaukelt einem das eigene Gehirn eigentlich nur vor? Welche Ängste haben einen realen Ursprung und wo verändern tatsächlich nur völlig aus dem Ruder gelaufene Prozesse im Gehirn die Wahrnehmung der Außenwelt? Eine wichtige Frage, mit der sich die Hirnforschung ja seit einigen Jahren intensiv beschäftigt. Denn inzwischen wissen wir ja, dass die Welt, wie wir sie wahrnehmen, eine Konstruktion in unserem Gehirn ist.
Eine Konstruktion, die uns nur dann überlebensfähig macht, wenn sie die äußere Welt wirklich adäquat abbildet und die richtigen körperlichen Wahrnehmungen auslöst. Ein sehr sensibler und komplexer Vorgang, der aber bei schizophrenen Erkrankungen aus dem Lot gerät. Und damit den Betroffenen da trifft, wo er am verletzlichsten ist: in dem, was er (oder sie) als Ich empfindet, das Zentrum seiner Weltwahrnehmung.
Aber was passiert, wenn man sich auf dieses Ich nicht mehr verlassen kann? Das ist ja immerhin etwas, was etliche Menschen in unserer Gesellschaft ja geradezu in Kauf nehmen, wenn sie sich mit Drogen aller Art volldröhnen und hinterher behaupten, sie hätten wunderwas erlebt, auch wenn sie in Wirklichkeit nur mit lauter bunten Chemiekeulen ihr fein austariertes Ich aus dem Gleichgewicht geballert und die Synapsen zum Hexentanz gebracht haben.
Und manche erleben am Ende einer Suchtkarriere das, was Schizophrenie-Patienten ganz ohne Verschulden erleben: wie sich dieses Ich tatsächlich mit Wahnvorstellungen füllt und die Wahrnehmung der Realität verschwimmt und damit das eigene Leben immer unberechenbarer wird.
Mara akzeptiert irgendwann, dass sie ein normales Leben niemals führen wird, dass sie auch bei der Freiwilligen Feuerwehr im Dorf nicht mehr mithalten kann und dass viele Wünsche, die man als junge Frau ans Leben hat, schlicht mit der Krankheit kollidieren. Irgendwann hat sie sich dann hingesetzt und ihre Krankheitsgeschichte in der dritten Person niedergeschrieben, sie quasi weit von sich gerückt, sodass sie mit einer gewissen Gefühlsdistanz erzählen kann, was Mara alles geschehen ist.
Man versteht diese Distanz. Anders wäre diese Geschichte wohl auch nicht erzählbar gewesen, die wahrscheinlich für viele Schizophrenie-Patienten sehr typisch ist. Das Büchlein kann also auch Menschen ein kleiner Ratgeber sein, die mit Angehörigen, Freunden und Kollegen zu tun bekommen, die an paranoider Schizophrenie erkrankt sind.
Man versteht dann vieles besser und bekommt ein Gefühl dafür, wie sehr die paranoide Schizophrenie in die Persönlichkeit eingreift. Dieses scheinbar so sichere Ich, von dem die meisten nicht mal ahnen, auf welche fein aufeinander abgestimmten Prozesse im Gehirn dieses Ich angewiesen ist, damit es uns möglichst ein Leben lang stärkt in dem Gefühl, tatsächlich selbst die Akteure unseres Lebens zu sein.
Mara Majeskie „Diagnose: Paranoide Schizophrenie. Ein Schicksal“, Ich Verlag, Leipzig 2019, 13,90 Euro.
Das zweite Vogel-Tagebuch von Hauke Meyer
„Die Wächter“ – Zwei Jahre zwischen Birdrace, politischem Furor und der Suche nach dem Wichtigsten im Leben
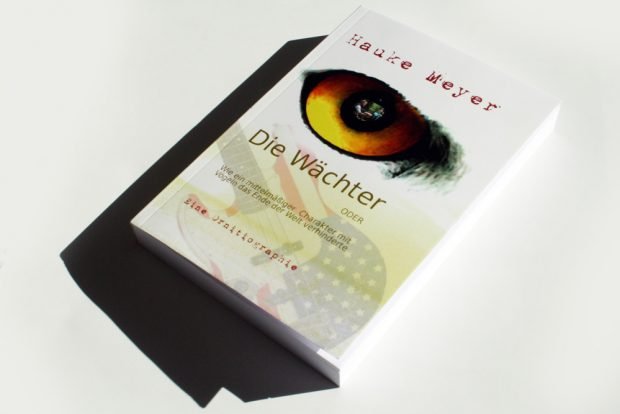
Hauke Meyer: Die Wächter. Foto: Ralf Julke
Für alle LeserSo ganz im Reinen war Hauke Meyer nach seinem ersten Buch 2015 doch noch nicht. Er hatte sich ja bekanntlich aufgemacht, nicht nur die Vogelwelt rings um seinen Wohnort Einbeck im Leinetal zu erkunden, sondern auch mit sich selbst besser ins Reine zu kommen. Er ist ja nicht der Einzige, der kurz vor der 40 mit sich selbst haderte und sich seiner Rolle als Mann in dieser Welt vergewissern wollte. Was ja, wie wir nun erfahren, einfach nicht aufhört.
Da helfen alle Posen nichts: Männern geht es genauso wie Frauen. Jeden Tag müssen sie sich neu einfinden in ihr Leben, in sich hineinhorchen und versuchen, den eigenen Wünschen, Bedürfnissen und Erwartungen nahezukommen.
Und eines scheint mir nun nach diesem zweiten Buch, das Hauke Meyer schon begonnen hat zu schreiben, bevor auch nur das erste ausgeliefert war, ziemlich deutlich: Er wird auch diesem Buch ein weiteres folgen lassen müssen. Eigentlich sind es ja schon zwei in einem.
Denn das erste beschreibt sein Jahr 2015, ein Jahr, von dem er ja anfangs nicht ahnen konnte, wie es am Ende ausgehen würde. Aber nachdem er im ersten Buch seine Leser schon mitgenommen hat, mit ihm die reiche Vogelwelt im Leinetal zu entdecken und seine ganz persönlichen Beziehungen zur Welt, zu seiner kleinen Familie und zum Kosmos der Vögel zu beschreiben, nahm er sich für den nächsten Band einen regelrechten Rekordversuch vor: Binnen eines Jahres wollte er 250 verschiedene Vogelarten im Leinetal nachweisen.
Das Leinetal ist dafür bestens geeignet – es ist eines der artenreichsten Gebiete in Deutschland. Und es hat eine interessierte Gemeinschaft von Vogelfreunden – samt Vogelwarte. Das Denken ist dort schon ein ganzes Stück weiter als im geplagten Leipziger Auenwald, der bislang noch ein ebenfalls artenreiches Refugium ist – mit höchster Gefährdung. Über 100 Vogelarten soll es hier geben. Es würde sich also lohnen, genauso wie Hauke Meyer so oft wie möglich mit Kamera und Spektiv loszuziehen und nach seltenen Vögeln Ausschau zu halten.
Vielleicht nicht ganz so getrieben wie im ersten Teil des Buches, denn das geht schief. Was er dann im zweiten Teil auch reflektiert. Denn auch für einen Hobby-Ornithologen ist es eine Leistung, 250 verschiedene Vögel nachweisen zu wollen, erst recht, wenn Arbeit und Familie ihre Forderungen stellen und man die Gänge ins Vogelrevier Frau und Tochter regelrecht abtrotzen muss – wobei gerade die Kleine, die im ersten Band 3 Jahre alt war, im Verlauf des Buches immer mehr Interesse zeigt für das, was der Vater tut. Und natürlich hat er recht. So pflanzt man wichtige Erfahrungen in die Kinder ein, die sie ein Leben lang behalten.
Schon gar vor dem eigentlich bedrohlichen Hintergrund, der ihm immer wieder bewusst wird.
Etwa wenn er dem Kind ein Rebhuhn zeigt und sich an seine eigenen Kindheitserlebnisse erinnert, als es nicht um ein Rebhuhn ging, sondern um ganze Schwärme davon. Auch im Leinetal ist es viel stiller geworden. Viele Vogelarten, die die Wege seiner Kindheit begleiteten, sind selten geworden, gelten gar als ausgestorben. Noch sind sie da, stellt er fest: die Wächter. Denn damit meint er die Vögel, die sein Leben begleiten und die uns beobachten.
Doch die Ruhe, mit der er ins Buch einsteigt, trügt. Denn auch ein Ziel wie 250 verschiedene Vogelarten zu entdecken, bedeutet Leistungsdruck. Er flucht zwar immer wieder auf die Gesellschaft und ihre Besessenheit. Aber eigentlich hat er es selbst verinnerlicht. Da geht er auf die 40 zu und lebt doch ständig unter (Leistungs-)Druck.
Viele kleine Szenen mit seiner kleinen Familie wirken von außen richtig dramatisch, wenn er vom Tisch aufspringt und losstürzt und seine Frau mit einem kurzen Spruch abspeist. Er will etwas leisten und sich beweisen. Was in diesem Jahr gewaltig schiefgeht, als er bei seinem ersten Versuch, mit einem Motorroller zu fahren, stürzt und sich das Schlüsselbein bricht.
Dass da etwas in ihm tobte, stellt er hinterher fast beiläufig fest – unduldsamer sei er geworden, rücksichtsloser. Das bekamen seine beiden Gefährtinnen wohl auch immer wieder zu spüren.
Und endgültig scheint er im Herbst 2015 außer Rand und Band zu geraten, weil ihn die mediale Vermittlung der Flüchtlingsaufnahme empört. Er meint zwar, das sei angeboren, Männer seien nun mal so – echte freiheitsliebende Krieger. „Männer neigen dazu, das Leben als stetigen Krieg wahrzunehmen. Gegen sich selbst, gegen seine Frau, die Gesellschaft als solches. Gegen alles eigentlich. Ich kann nichts für meine genetische Veranlagung und bin sicher nicht nur von der Gesellschaft dazu gemacht, wie mir das einige übereifrige Forscher weismachen wollen.“
Dabei arbeitet er als Sozialpädagoge. Da verblüfft das schon. Weil er ja an anderer Stelle zu Recht bezweifelt, dass es „die Gesellschaft“ gibt. Gibt es ja auch nicht. Das ist ja der Punkt, an dem man dem Einbecker Eigenbrötler sofort zustimmen möchte. Die großen Raster sind falsch. Sie erzeugen eine Gemeinsamkeit, wo es keine gibt. Jedenfalls nicht in der Form.
Und schon gar nicht, wenn in einem Mann noch immer der jugendliche Punk steckt, der seinen Eigensinn gegen die ganze Welt behaupten will. Die Stars seines Lebens heißen „Status Quo“, Ramones und Gunter Gabriel. Doch die alten Barden sterben. Das Jahr ist überschattet von Todesmeldungen und auch Hauke Meyer schreibt vieles übers Altern und das Altsein. Mit 40? Man staunt. Da rumort es wirklich gewaltig in ihm.
Als er sein erstes Buch noch einmal liest, merkt er, dass es nicht ganz so besorgt und in Moll geschrieben war. Das zweite liest sich wehmütiger, mit einem fast tragischen Unterton: „Mein Leben. Eine Mischung aus Resignation, Lebensfreude, Zweifel und Protest in diesen Tagen. Wutbürger.“
Es scheint die Flüchtlingsdebatte zu sein, die ihn aufregt. Gleich will er sich das kritisierte Pirinci-Buch besorgen. Im zweiten Teil wird er gar zum Trump-Fan, obwohl er mit den deutschen Rechtsaußen nichts anfangen kann. Man merkt schon, wie er das alles im Grunde postwendend in seinen Computer schreibt und sich weigert, die Passagen, die möglicherweise auf Protest stoßen, zu löschen.
Es ist eine sehr ernsthafte Selbstbefragung – die (für den Leser) nicht immer zu logischen Erkenntnissen führt. Aber auch das ist Leben. Und hier versucht wirklich einer, sein eigenes Dasein zu fassen: Was macht ihn den besonders? Welche Rolle spielt er in der Welt?
So weit gehen nicht viele. Schon gar nicht mit sich selbst. „Auf der Hinterbühne der Vorderbühne bin ich gleichzeitig Zuschauer, Regisseur und Nebendarsteller. Freiheit ist ein Abenteuer. Die Freiheit, Lebewesen beim Sein zu beobachten, Glück und Inspiration.“
Da hat man ihn fast beieinander – einen, der viel grübelt, Momente der Ruhe zur Selbstreflexion nutzt, aber eben doch lieber alles allein klären will. Freiheitsdrang und Eigensinn. Am Ende dann sogar das Trump-T-Shirt, um genau diesen Eigensinn zu behaupten. Und man versteht ihn ein bisschen. Irgendwie brachte dieser Trump ja wirklich Wind in die (amerikanische) Politik.
Die Präsidentschaftswahl ist fast schon der Schluss des Buches, Ende 2016. Das Jahr hat Hauke Meyer genutzt, jetzt doch mit etwas mehr Ruhe und Besinnung auf Vogelpirsch zu gehen. Denn die 250 Vogelarten gleich im ersten Jahr alle sehen zu wollen, das hat nicht geklappt. Das hat nur enormen Stress verursacht. Und dabei sucht er ja bei der Beobachtung der Vögel genau das nicht.
Denn dass es selbst im vogelreichen Leinetal um so viel stiller geworden ist als in seiner Kindheit, das schwingt als Sorge immer mit. „Insgesamt aber ist es stiller geworden in der Welt. Gehe ich in Gedanken an die Orte zurück, an denen ich war, insbesondere die Wälder und Wiesen der Umgebung, dann ist Stille mein Begleiter gewesen. Eine gespenstische Ruhe.“
Nicht nur um die Insekten steht es schlecht, auch um unsere Vogelwelt.
„Einer der Gründe, warum ich dieses und das Buch davor geschrieben habe, ist auch von der Hoffnung genährt, dass mehr Menschen hinsehen und sich dafür interessieren, welche Kreaturen sie in ihrer Welt umgeben.“
Man muss seine politischen Ansichten nicht teilen. Sie sind stark auch geprägt von Eigensinn. Was eigentlich – in völlig anderer Beziehung – ein Ansatzpunkt wäre zu verstehen, was Männer eigentlich in einer Gesellschaft umtreibt, in der die (alten) Männerbilder nicht mehr zur Wirklichkeit passen. Und es geht ja nicht nur Punkern, Rockern und FDP-Wählern so, dass Freiheit auch immer ein Ort der Selbstbestätigung und Selbstbehauptung ist. Und Eigensinn eben auch eine Form der Freiheit – sich eben nicht mehr alles vorsetzen lassen zu wollen.
Was auch Haukes Grimm auf die Grünen ein wenig verständlich macht, die er mal gewählt hat, die er aber irgendwie als Bevormundungspartei begreift. Obwohl sie ihm in ihrem Kern ja nahe sein müssten – näher jedenfalls als unsere großen Konsum- und Wirtschaftsparteien.
Aber er trennt das. Und das zweite Jahr geht er ja sowieso ruhiger an, denkt auch mehr über große Themen wie Liebe, Mut und Freiheit nach. Und fast zum Schluss kommt er zum Kern dessen, was ihn fast jeden Tag in den Polder treibt. Ein Fasan ist seine Nummer 250. Aber ist es das, was am Ende zählt?
„Nein! Es geht nicht darum, dass ich irgendein ‚Birdrace‘ gewinne. Es geht darum, das Rennen zu beenden. Ja, es zu beenden. Aber danach ist es wichtig, anderen Menschen zu helfen, es auch zu schaffen. Vielleicht habe ich gelernt, was wirklich zählt und wie wertvoll dieses Leben ist und wie schnell es uns genommen werden kann. Die Vogelbeobachtung hat mich gelehrt, für den Moment zu leben.“
Ein bisschen entschuldigt er sich noch bei den geschulten Vogelbeobachtern im Leinetal. Aber allein schon die schiere Zahl der unterschiedlichen Vögel, über deren Entdeckung er sich freut, zeigt dem ganz und gar nicht bewanderten Leser, dass es da draußen noch einen Reichtum zu entdecken gibt. Einen gefährdeten Reichtum. Schon für seine vierjährige Tochter fürchtet er, dass sie ihren Kindern nicht einmal mehr das zeigen kann, was er ihr zeigt, während sie beide auf der Bank sitzen und das Geflatter auf dem See beobachten.
Hauke Meyer Die Wächter, I.C.H. Verlag, Leipzig 2018, 15,90 Euro.
Hauke Meyers lange Suche nach dem Grund für die Unruhe und nach der eigentlichen Schönheit des Planeten Meyer
22. Februar 2018 Ralf Julke Bildung > Bücher Keine Kommentare
Eine schmerzhafte und eindrucksvolle Autobiografie
Emmas langer Weg aus der Hölle von Magersucht, Selbstverletzungen und Verzweiflung
Friederike Wendlandt: Leben auf Umwegen. Foto: Ralf Julke
Schon im Programm des Einbuch Verlages fielen diese Bücher auf, weil sie authentisch aus dem Leben (junger) Menschen erzählen. Dem richtigen Leben, dem, in dem es Mobbing gibt, Alkoholismus, überforderte Eltern, Stress, Armut, ADHS oder – wie in Friederike Wendtlands Buch: Magersucht, Drogen und Selbstverletzung. Das Besondere: Die jungen Autorinnen erzählen selbst über ihr Leben.
Und dazu gehört jede Menge Mut. Nicht nur für den Schritt an die Öffentlichkeit, sondern vor allem dafür, sich den eigenen Dämonen zu stellen. Und das sind keine jagdbaren TV- oder Kinofilm-Dämonen. Diese Dämonen wohnen in uns. Sie sind die Ängste, Nöte, Zwänge, die uns zu Handlungen treiben, die uns nicht guttun. Unsere Gesellschaft ist voll davon. Denn viele dieser Nöte korrespondieren mit den falschen Vor-Bildern einer Gesellschaft, in der es eigentlich nicht um den Menschen geht, sondern um das Verkaufen, falsche Schönheitsideale und etwas noch viel Schlimmeres, was trotzdem immer wieder lobhudelnde Texte in großen Medien bekommt: die „Perfektionierung“ des menschlichen Körpers. Vor allem des weiblichen.
Und natürlich sind Kinder und Jugendliche dafür anfällig. Gerade dann, wenn sie mit ihrem Gefühlsleben sowieso im Umbruch sind. Jeder weiß, was für ein Chaos diese Zeit ist, in der der Kopf voller Träume, Befürchtungen und Zweifel ist. In der man eigentlich mehr Halt und Zuspruch braucht und gleichzeitig um mehr Distanz und Souveränität kämpft. Da reicht manchmal eine falsche Anregung, ein kleiner Schritt in die falsche Richtung, und man gerät in ein Drama, wie es Friederike Wendtlandt hier erzählt. Sie nennt ihre Protagonistin Emma – auch wenn das Buch trotzdem autobiografisch ist. Und dass es die heute 22-Jährige schreiben kann hat damit zu tun, dass sie in der Zeit, als ihr das passierte, immer auch Tagebuch geschrieben hat.
So gelingt ihr etwas, was man in Büchern zu solchen Themen eher selten findet: eine unbarmherzige Innensicht verbunden mit den Erläuterungen der jungen Frau, die das alles überlebt hat und in Teilen auch einordnen kann. Auch wenn nicht alles erklärbar ist. Denn eigentlich hatte Emma eine gute und geborgene Kindheit, war gut in der Schule und ihre Eltern bemühten sich, ein ordentliches Familienleben zu meistern. Dass das so heil nicht war, erfährt der Leser auch. Aber eher auf die ratlose Art, so wie das bei vielen Paaren ist, wo die Frau versucht, ja jeden Streit zu vermeiden und die Harmonie in der Familie zu bewahren, und der Mann in seiner Strenge oft übers Ziel hinausschießt, weil er glaubt, sonst seine Rolle nicht auszufüllen.
Eine Situation, in der sich Heranwachsende oft überfordert und unverstanden fühlen, weil etwas Wichtiges fehlt. Nur ist Emma wirklich ein kluges Mädchen. Und erzählen kann sie auch. Und spätestens als sie ihren Vater weinend am Steuer des Autos zeigt, weil er den Absturz seiner Tochter nicht wirklich versteht und verkraftet und sich trotzdem schuldig daran fühlt, merkt man, dass so ein Drama immer das Drama aller Beteiligten ist. Eltern, denen es genauso geht, werden sich bestimmt manchmal wiedererkennen – auch wenn das nichts am Betroffensein ändert.
Denn Friederike alias Emma lässt nichts aus. Man merkt, dass sie wirklich wissen will, warum ausgerechnet ihr das passierte und wie das Thema Magersucht ausgerechnet sie in den Griff bekommen konnte, wo sie doch schon bei der ersten Begegnung mit dem Thema wusste, dass das eine Falle war, in die man nicht tappen darf. Und doch ist es ihr passiert, wird aus Neugier Abhängigkeit und ein rebellischer Geist muss verzweifelt zuschauen, wie er sich selbst immer mehr in der Denkfalle verfängt und das Körpergewicht und das (Nicht-)Essen auf einmal zum dominierenden Thema werden. Wie aus einem Ausprobieren tatsächlich eine Krankheit wird, die Emma die nächsten vier Jahre im Griff haben wird und sie immer weiter an den Rand der Selbstaufgabe bringt.
Das geht unter die Haut, weil man ihr zusehen kann dabei, wie sie kämpft und leidet und an den Niederlagen immer mehr verzweifelt. Irgendwann werden Besuche in der Notaufnahme und Klinikaufenthalte zum Normalzustand, schmilzt die Hoffnung, aus dem Kreislauf auszubrechen, immer mehr. Denn die Verzweiflung sitzt im Kopf. Und auch die vielen professionellen Helferinnen und Helfer, denen man begegnet, sind sichtlich oft genug entmutigt. Denn wenn sich Emmas Sehnsucht nach Kontrolle über ihr Leben und ihren Körper immer wieder mit Magersucht und Selbstverletzung koppeln, ist der Weg regelrecht mit Dornen gepflastert, aus diesen Zwängen herauszukommen und einen Weg zu einem anderen, nicht-verletzenden Selbstbild zu kommen.
Erst recht, weil Emma klug ist, ein Mädchen, das augenscheinlich problemlos ihr Leben meistert, Menschen beeindruckt, Hockey spielt. Und früh schon scheint es ihr zu gelingen, den Zwängen zu entkommen, wieder Tritt zu fassen – umso heftiger sind auch für den Leser die Rückfälle, die immer schmerzlicher werden. Auch immer finsterer. Das Buch ist nicht nur eine sensible Nacherzählung des Erlebten. Es ist auch gespickt mit Gedichten und Tagebucheinträgen, die von Emmas Stimmungslage erzählen, von ihrer Verzweiflung und Ausweglosigkeit, die sie in langen Phasen nur ihrem Tagebuch anvertraut. Da scheint niemand zu sein, dem sie sich wirklich anvertrauen kann. Aber das stimmt nicht ganz. Auch wenn es lange braucht, bis Emma zu den ersten Menschen, die sich die ganze Zeit um sie sorgen, Vertrauen aufbaut.
Ihre Eltern sind es nicht. Im Gegenteil. Gerade Emmas Suche nach einer richtigen Autonomie macht deutlich, dass ihre Eltern damit nicht wirklich umgehen können – und doch irgendwie froh sind, dass ausgerechnet ihre Tochter diesen Part übernimmt. Denn anders als sie hat Emma gelernt, über Kümmernisse, Wünsche und Hoffnungen zu sprechen. Also von sich. Und sie lernt auch, sich Hilfe zu holen, über den eigenen Schatten zu springen und nicht allein ins Loch der Verzweiflung zu stürzen. Auch wenn es lange dauert und man mit ihr heulen möchte, wenn sie wieder abrutscht, gar den Drogendealern am Görlitzer Park in die Fänge gerät. Auch das so eine Geschichte, wo man erst einmal innehält und sich fragt: Wie kommen denn eigentlich die anderen Kinder und Jugendlichen in diese Szene? Sind es bei ihnen nicht ganz ähnliche Ursachen und Nöte, die sie dort das Heil suchen lassen, wo es scheinbar schnell zu haben ist?
Nur so als Frage.
Ich schätze, jungen Menschen mit einer richtigen Drogensucht wird es noch viel schwerer fallen, so ihre Lebens- und Leidensgeschichte aufzuschreiben. Emma stürzt zwar tief – aber nie verliert sie diesen kritischen, aber auch hoffenden Blick auf sich selbst. Sie weiß die ganze Zeit, dass sie aus der Spirale heraus muss, und sie weiß auch, dass ihr viele Menschen geduldig dabei helfen.
Aber was dann wirklich der rettende Ausweg ist, das muss sich erst herauskristallisieren. So wie eigentlich jeder junge Mensch den Weg zur eigenen Autonomie finden muss – oft genug gegen falsche Erwartungen, falsche Forderungen und Leit-Bilder. Am Ende läuft das Mädchen Marathon – und hat gleichzeitig einen Marathon der Torturen hinter sich, bei dem sie oft genug am Aufgeben war. Und man wird das Gefühl nicht los, dass viele junge Menschen solche Kämpfe ausstehen müssen. Und zwar gerade die klugen und sensiblen, denen Autonomie in ihrem Leben besonders wichtig ist. Diese so schwer errungene Autonomie, die uns so nehmen lässt, wie wir sind – und trotzdem eigensinnig bleiben lässt. Gegen die meist unausgesprochenen Erwartungen der Menschen um uns. Denn oft ist das Unausgesprochene viel prägender und bedrückender als das, was wirklich geäußert wird. Auch wenn es in Emmas Fall wirklich Worte zu sein scheinen, die am Anfang stehen, Worte, die ihr Vater vielleicht nicht so gemeint hat – und die doch eine unheilvolle Kette in Gang setzten.
Eigentlich ist das Buch auch ein Appell an mehr Achtsamkeit in unserem Umgang miteinander. Und natürlich auch ein Versuch zu zeigen, wie leicht ein junger Mensch in diese gefährlichen Mühlen gerät – und wie viel Ermutigung und Hilfe gebraucht wird, ihm beim Verlassen dieser Abgründe zu helfen. Und es ist eine Ermutigung, dass es trotzdem geht. Dass sich der dornenreiche Weg lohnt, eine andere, weil lebendige Autonomie zu gewinnen und das eigene Leben dann wirklich anzupacken mit beiden Händen. Darum geht es ja eigentlich.
Aber man ist ja seitenweise mit dabei, mitten in der Verzweiflung und dem Verlorensein. Das ist intensiv erzählt, für Distanz ist da kein Platz. Aber gerade deshalb berührt es auch. Und macht die Heldin selbst in ihren traurigsten Phasen vertraut. Man versteht sie nur zu gut und möchte am liebsten selber mithelfen, sie aus dem Schlamassel zu holen. Aber sie schafft es wirklich allein. Sonst hätte sie sich ja nicht hinsetzen können und sich noch einmal mit all ihren Tagebüchern konfrontiert und daraus nun diese Lebensgeschichte gemacht. Diese Lebensanfangsgeschichte. Denn wenn man den ersten Schritt getan hat, geht es ja erst los. Man weiß, dass man startet – aber man weiß nicht, wohin man dann gelangt. So ist das Leben.
Friederike Wendlandt Leben auf Umwegen, EINBUCH Verlag, Leipzig 2018, 15,90 Euro.
Wenn die eigenen Gefühle tief unterm Panzer stecken
Majas langer und tränenreicher Weg aus dem Missbrauchs-Trauma zu einem neuen, lebendigen Ich

Maja Marlen Hope: Vom zersplitterten Spiegel zum bunten Mosaik. Foto: Ralf Julke
Vor einem Jahr sorgte Annett Leander mit ihrer wütenden Kindheitserinnerung „Umarme mich – aber fass‘ mich bloß nicht an“ im Einbuch Verlag für richtig Aufmerksamkeit. Das Thema hatte es ja in sich: Missbrauch in der Familie. Doch sexueller Missbrauch findet nicht nur in von Alkohol gezeichneten prekären Familienverhältnissen statt. Und die Folgen sind immer heftig.
Darüber schreibt in diesem Buch die Österreicherin Maja Marlen Hope. Bei ihr steht freilich die schwere, zermürbende Aufarbeitung des Traumas im Vordergrund. Denn sie gehört wohl zur Mehrheit der Betroffenen, die die frühen, traumatischen Erlebnisse lange verdrängt haben, abgekapselt irgendwo im Unterbewussten, weit weg von ihrem Leben, das sie augenscheinlich mit viel Erfolg, Leistungs- und Abenteuerlust verbringen. Bis zu dem Moment, an dem sich der Körper selbst zu Wort meldet und einfach streikt. Denn das auf Hochtouren gebrachte Leben mit einem enormen Arbeits- und Leistungspensum, das so gut zu unseren heutigen Vorstellungen von dem passt, was wir glauben aus unserem Leben machen zu müssen, entpuppt sich auf einmal als etwas, was auch Maja Marlen Hope so nicht gedacht hätte: als regelrechte Flucht nicht nur vor den bedrückenden Erinnerungen, sondern auch vor ihren eigenen Gefühlen.
Als gar nichts mehr geht, entschließt sie sich, zurückzukehren in ihre Heimatstadt und sich den eigenen Verletzungen zu stellen, therapeutisch Hilfe zu suchen und vor allem den Onkel, der ihr das angetan hat, vor Gericht zu bringen – freilich nicht ahnend, dass nicht nur Menschen zum Verdrängen von Dingen neigen, die sie nicht wahr haben wollen, sondern auch ganze Apparate. So wird ihre Begegnung mit der Justiz tatsächlich zu einer Wiederholung des Traumas und zur Begegnung mit Männern, die all ihre Macht darauf verwenden, Opfern das Geschehene ausreden und Täter vor jeder möglichen Strafe schützen zu wollen. Dass sich der österreichische Staat genauso verhält und am Ende jede Unterstützung mit fadenscheinigen Argumenten versagt, spricht für sich.
Würde Maja nicht im Verlauf ihrer langen quälenden Reise zu sich selbst auch Menschen kennenlernen, die ihr trotzdem in den schwärzesten Stunden beistehen, sie hätte die Tortur wohl nicht durchgestanden. Denn für die Opfer eines Missbrauchs ist die Aufarbeitung immer eine Tortur. Sie brauchen dabei nicht nur professionelle Begleitung, die tief vergrabenen Erlebnisse und Verletzungen aufzuarbeiten. Sie brauchen auch Menschen, die in den Stunden und Tagen danach bereit sind, ihnen Halt und Trost zu geben. Denn was da erweckt wird, sind natürlich die unverhüllten, jahrelang ignorierten Gefühle des verletzten Kindes.
Das eben nicht nur körperlich verletzt wurde, sondern in seinem tiefsten Vertrauen missbraucht wurde. Es ist nicht nur bei Maja so: Die meisten Missbräuche geschehen im engsten Familienkreis und durch Personen, die für die Kinder und Jugendlichen eigentlich Vertrauenspersonen sind, geliebte und oft sogar angehimmelte Familienmitglieder. In diesem Fall der Onkel, der zudem die Fähigkeit besitzt, Menschen, mit denen er zu tun hat, zu manipulieren. Dass Maja das Erlebte so lange verdrängen konnte, hatte auch mit der Drohung des Onkels zu tun, sie dürfe niemals darüber reden. Aber auch mit dem schäbigsten aller Momente, als er das Mädchen mit Beginn der Pubertät regelrecht erniedrigte und wegschickte mit der Behauptung, jetzt gefiele sie ihm nicht mehr.
Zu einem Gerichtsprozess gegen den Mann ist es nicht gekommen. Der zuständige Staatsanwalt weigerte sich einfach, sich mit dem Fall ernsthaft zu beschäftigen.
Dabei ging es Maja auch nicht um Strafe oder Rache, sondern eher um Einsicht und eine Entschuldigung. Doch die bekam sie nicht. Im Gegenteil. Die Großeltern deckten lieber den Täter.
Majas Eltern und ihre Schwester aber hielten zu ihr, so dass sie auch etwas entdecken konnte, was sie vorher nie zugelassen hätte: Sie um Hilfe zu bitten in der Not.
Denn wenn Vertrauen derart gründlich zerstört ist, dann wird das Opfer sich ein Leben lang mit Sätzen plagen wie „Ich bin es ja doch nicht wert“ oder „Ich habe gar nicht verdient, dass mich jemand liebt, so wie ich bin“ usw. Die Therapeuten werden all das nur zu gut kennen. Denn die Zahlen sind hoch. Der verdrängte Missbrauch macht die Betroffenen immer wieder zum Opfer, denn wenn sie die Muster nicht kennen, suchen sie sich auch immer wieder Partner, die das Trauma bestätigen, sie erleben neue Erniedrigung und Zurückweisung. Und wandeln es im Kopf in harmonische Beziehungen um.
Doch im Unterschied zu vielen Betroffenen, die sich der bedrückenden Last nicht stellen wollen, nimmt Maja die Herausforderung an. Sie kämpft, sucht sich Hilfe und Freunde, lernt auch noch Yoga und Kampftechniken, um auch ihren Körper besser verstehen zu lernen. Und je tiefer sie sich in die schmerzlichen Erinnerungen und in die Schutzpanzer ihrer Emotionen hineinarbeitet, umso hellsichtiger wird sie auch im Blick auf ihre Mitmenschen. Sie merkt, dass es nicht ihre Emotionen sind, die sie betrügen, sondern ihre Vernunft, die so lange Jahre hilfreich war, weil sie dafür sorgte, die Verzweiflung fernzuhalten. Doch damit war auch all ihre Lebendigkeit, ihre Sexualität und ihr Selbstvertrauen unter Verschluss. Sie funktionierte nur noch und war in Liebesbeziehungen immer das suchende, unterwürfige Kind.
Das Buch hat Maja Marlen Hope quasi zum Abschluss ihrer Trauma-Therapie geschrieben, an dem Punkt, an dem für sie endlich greifbar war, was sie alles verdrängt hatte und was das mit ihrem Körper und ihren Emotionen angestellt hatte. Sie hatte sich den schlimmsten Erinnerungen gestellt. Ob die Reise in die Tiefe am Ende heilsam war, weiß sie noch nicht. Doch allein die Intensität der Beschreibung dessen, was sie in den drei Jahren erlebt, erzählt von einer unbändigen Lust aufs eigene Leben. Sie hat nicht nur Vertrauen neu gelernt und das zutiefst verletzte Kind in sich gefunden. Sie hat auch die Sensibilität eines Körpers gefunden, der ihr scheinbar über all die Jahre fremd war.
Natürlich ist es ein Buch, das anderen, die Ähnliches erlebt haben, Mut machen soll. Auch wenn es höchst emotional ist. In Tagebuchauszügen taucht die Autorin immer wieder in die vergangenen Phasen der Therapie zurück. Sie lässt auch die heftigen Abstürze nicht weg. Denn wenn man solche Erfahrungen über Jahre tief verschlossen hat, dann ist die Begegnung mit ihnen heftig. Dann kommen selbst Erlebnisse aus der jüngeren Vergangenheit wieder hoch – und die Autorin erschrickt. Denn augenscheinlich hat ihre Vernunft auch später in gefährlichen Situationen immer wieder auf Verdrängung geschaltet, so dass sie sogar von Glück sagen kann, dass sie lebendig bis an den Punkt gekommen ist, an dem sie sich der Sache stellen konnte.
Und natürlich macht das Buch sehr nachdenklich. Denn wenn diese Dinge so oft passieren, was richtet das eigentlich mit unserer Gesellschaft an? Wie viele Menschen tragen diese Erfahrungen in sich, unfähig, daran auch nur zu rühren? Hängt die panische Flucht vieler „Leistungsträger“ unserer Gegenwart vor Verständnis, Mitgefühl und Emotionen vielleicht sogar genau damit zusammen: mit dem Verdrängen? Kann es sein, dass die heutige Anhimmelung des permanent Verfügbaren genau damit zusammenhängt: Eine ganze Gesellschaft stürzt sich lieber blindlings in Dauerhöchstleistungen, um sich ja nie den Verletzungen zu stellen, die ihre Leistungsträger erlitten haben?
Und wie ist das mit diesen erfolgreichen Manipulateuren, die ihre ganze Umgebung dazu bringen können, sie anzuhimmeln und immer wieder neuen Missbrauch von Vertrauen zu ermöglichen? Die sich gegenseitig schützen gegen Anklagen und Machtentzug? – Alles nicht ganz abwegige Fragen. Die aber natürlich über das Buch hinausgehen, das vor allem davon erzählt, dass es sich lohnt, um seine eigene Heilung zu kämpfen, sich echte Freunde und Unterstützer zu suchen und die falschen Programmierungen im Kopf aufzulösen, die einst so wichtig waren, um das Überleben zu sichern, die irgendwann aber selbstzerstörerisch werden. Denn wenn man keinen Zugang mehr hat zu seinen eigenen Emotionen, wenn man sich dem Leben nicht mehr gewachsen fühlt, dann neigt man logischerweise zum Aufgeben. Dann behalten die Botschaften des falschen Über-Ich Recht. Eine scheinbar ausweglose Situation, wenn man nicht – wie Maja – darum kämpft, das Verlorene und Verschlossene wiederzugewinnen, wieder eins zu werden mit sich.
Es ist – das weiß man nach dem Lesen dieses Buches – ein hartes und tränenreiches Stück Arbeit.
Aber auch ein erhellendes, denn Maja lernt auf ihre Emotionen zu achten und die zerstörerischen Männer zu meiden. Denn Männer, die ihre Beziehungen nur danach bewerten, wie viel Macht sie über ihre Partner haben, gibt es genug. Männer, die selbst voller unverarbeiteter traumatischer Erlebnisse aus der Kindheit sind, auch. Lösen kann man das nur, indem man sich wirklich – wie Maja – dem eigenen Klärungs- und Heilungsprozess stellt. Und auch wenn es schwer ist, zeigt die Autorin mit ihrem Buch, dass es geht, dass man Freunde und Freundinnen findet, die einem helfen dabei, ein Netzwerk von Menschen, die einen verstehen, trösten und tragen. Die einem ein Stück weit genau das zurückgeben, was der Täter einst zerstört hat: das Vertrauen zu nahestehenden Menschen und vor allem in die eigene Kraft und Lebendigkeit.
Ein Jahr auf Vogelpirsch im Leinetal
Hauke Meyers lange Suche nach dem Grund für die Unruhe und nach der eigentlichen Schönheit des Planeten Meyer
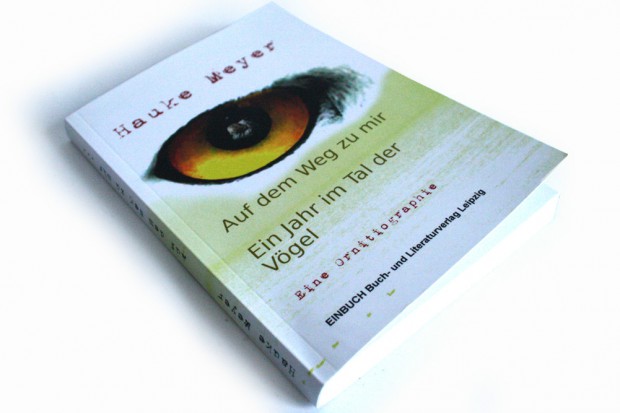
Hauke Meyer: Auf dem Weg zu mir. Foto: Ralf Julke
Was passiert eigentlich, wenn ein Mann mitten im Leben, so kurz vor der 40, ins Grübeln gerät über sein Leben, die Welt, die Politik und den ganzen Rest? Passiert ja nicht allzu häufig. Viele haben in dem Alter ihren Kopf schon ausgeschaltet, spulen nur noch ab, plappern nach, funktionieren. Und kommen auch nicht auf die Idee, dass etwas falsch sein könnte an ihrem Leben.
Wenigstens nachdenken wollte Hauke Meyer mal über den ganzen Kram. Die Unruhe steckte in ihm. Er hatte seinen Job als Sozialpädagoge, der jungen Menschen nach ihrer katastrophalen Bildungskarriere erklärte, wie man wieder „zurück ins System“ kommt und sich dabei an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zieht. Man kann ihn sich schon vorstellen, den „besten Sozialpädagogen der Republik“, wie er die Entmutigten, Lustlosen, Frustrierten bei ihrem Stolz packt, ihrer angelernten Dünkelhaftigkeit und ihrer „Ist doch eh egal“-Stimmung, herausfordert, nervt und ärgert und gerade mit seiner Schnoddrigkeit dazu bringt, wieder ein bisschen Laufen zu lernen.
Er lebt noch immer in Einbeck, der Stadt, wo er aufgewachsen ist. Früher war er mal Punk, auch irgendwie links. Ein echtes Kind der 1980er, die seine Kindheit und Jugend geprägt haben. Seine Schulzeit war überschattet von der Dauerregentschaft Helmut Kohls. Es war die Zeit, als die Engländer die beste Musik der Welt machten. Die Scheiben hat er noch heute. Und die Songs dieser Jugend schleichen sich auch in dieses Buch, das ein wenig von seinem großen Faible erzählt: der Vogelbeobachtung. Birdwatching. Birder nennt er sich und weiß sich im Leinetal in bester Gesellschaft mit Gleichgesinnten, die ebenso beharrlich losziehen, um die Vogelwelt zu beobachten. Eine Welt neben unserer Welt. Da spotten selbst Haukes Freunde: Zwölf Vogelarten werde er wohl beobachten. Viel mehr kennt ja der unaufmerksame Laie nicht.
Aber so ganz zufällig ist Hauke Meyer nicht zu seinem Hobby gekommen. Da haben ihn ein paar Großväter angefixt, wie das oft so ist. Manchmal merkt man erst spät, wie wichtig die alten Knaben waren und wie ihre Worte nachleben in uns. Vielleicht sogar absichtslos erzählt, gezeigt. Schau hin. Präg es dir ein. Vögel sind nicht nur Vögel. Der Reichtum liegt im Detail. Und nur wer genau hinschaut, merkt, wie reich unsere Welt ist. Noch.
Das ist Hauke Meyer sehr bewusst, auch wenn die letzten Jahre für den raubeinigen Familienvater doch sehr ernüchternd waren. Das erspart er dem Leser gar nicht. Und es ist irgendwie vertraut. Denn wer in seiner Jugend Typen wie Hans-Dietrich Genscher, Helmut Schmidt und Gregor Gysi erlebt hat und mit dem vergleicht, was heute auf der politischen Bühne passiert, der kommt schon ins Grübeln. Auch über die Republik, die irgendwie in seltsames Fahrwasser geraten ist. Denn es ist schon eigenartig, wenn 2014 eine Stimmung im Land ist, in der ein Helmut Schmidt mit Sicherheit die Wahl zum Bundeskanzler gewonnen hätte.
Aber weder die SPD ist noch, was sie mal war, weder haben die Grünen oder die Linken noch die Glut der frühen Jahre.
Das kann täuschen. Meyer schreibt ja einfach drauf los. Wenn ein Thema ihn packt, versucht er es so klar wie möglich zu formulieren, bevor er weitermacht mit dem Aufzählen von Vögeln, die er in den Poldern an der Leine beobachtet hat. Denn um in diesem Jahr 2014 seinen Lebensfaden zu finden, hat er sich vorgenommen, wenigstens 200 Vogelarten zu beobachten. Das zwingt zum Innehalten, zum Aufmerksamsein, zum Rausgehen sowieso, auch wenn er Dutzende allein schon im Garten vor seinem Haus am Wald beobachten kann.
Er versucht, zeitnah alles niederzuschreiben, wissend, dass auch das Leben dazwischen kommen kann. Und zum Jahresende kommt es heftig dazwischen. Da wird er dann auch gezwungen, über das Elementarste nachzudenken. Da werden auch die Töne etwas weniger ruppig und hemdsärmelig.
Der Leser merkt es schnell: So leicht auszuhalten ist dieser Hauke Meyer nicht. Das gibt er auch gern zu. Seiten füllt er mit Beschreibungen seiner Unzufriedenheit, seiner Selbstzweifel – immer wieder konterkariert mit der Betonung, dass er doch nur ein ganz gewöhnlicher, mittelmäßiger Mensch sei, der die Dinge, die er sich wünscht, auch eigentlich hat. Aber woher kommt dann die Unruhe?
Am Ende scheint sich das zu klären. Und das ist schon etwas, was den meisten Mittelmäßigen im Land in der Regel früh verloren geht. Denn die eigentliche Triebkraft im Leben ist die Neugier auf immer Neues, auf die Erweiterung des eigenen Horizontes. Das hält lebendig. Wer also dachte, dass dieser Bursche, der deutlich betont, dass er ganz bestimmt nicht konservativ, eher ein echter Liberaler sei mittlerweile, nun irgendetwas übrig hätte für die neuen Renitenten von der AfD und ihrer Dresdener Begleitmusik, der irrt. Für diesen Haufen der Verlaufenen hat er überhaupt kein Verständnis.
Man merkt, dass seine Unzufriedenheit mit Grün und Rot und Rosarot woanders herkommt – auch aus einer gewaltigen Enttäuschung, die er wahrscheinlich mit Millionen anderen in diesem Land teilt. Eine Enttäuschung, die er so nebenbei auch noch in einer Oi-Punk-Band auslebt. Ein Liedtext für die Band bringt sein Hadern auf den Punkt. Denn wenn das Liberalsein in Egoismus umkippt, dann werden auch die spätrevolutionären Punk-Posen eher aggressiv als sinnstiftend: „Ich leb‘ mein Leben nach meinen Regeln und weißt du was, das Leben gibt mir Recht – ich schulde keinem etwas, hör nur auf mich selbst.“
Dabei lebt sein Buch von genau diesem Widerspruch, dass er eigentlich Leute, die sich nicht an Regeln halten, gar nicht mag. Leute, die nur im Schwarm flattern aber auch nicht. Womit er ja den Grundwiderspruch einer Zeit benennt, die die größten Egoisten feiert, im Wesen aber an einer zunehmenden Kälte und Oberflächlichkeit leidet. Manchmal gehen die Argumente mit ihm durch und manchmal passen sie auch nicht zusammen. Aber im Nachwort betont er auch, dass er lieber nichts redigiert hat, weil auch das zu seinem Naturell gehöre. Der Widerspruch muss raus.
Aber er findet dann doch etwas Wesentliches. Auch eine Variante des scheinbar zelebrierten Egoismus, die eigentlich etwas anderes ist, nämlich die Fähigkeit, einen eigenen Weg zu wählen und auch dazu zu stehen. Sich eben nicht einfach von anderen dirigieren und irgendwohin schubsen zu lassen. Auch das gibt genug Konflikte und Reibungsstellen – mit Eltern, Lehrern, Kollegen. Wer kennt das nicht? Aber mal ehrlich: Ein eigenes Leben wird nur draus, wenn man auch dazu steht. Und zwar nicht nur mit renitenter Punk-Pose, sondern so: „Liebe und Hingabe im Sinne der Sache – alles andere ist Illusion.“
Das haut er seinen Freunden in der Stammkneipe dann auch noch einmal um die Ohren. Und auch das hat mit seiner Beobachtung der Vögel zu tun. Denn gerade durch das Kommen und Gehen, das Dableiben und Ausbleiben all dieser Gefiederten, von denen viele auf der Roten Liste stehen, wurde ihm auch bewusst, mit welcher Beharrlichkeit die Vogelarten versuchen, ihr Überleben zu sichern: „Vögel jammern nicht. Vögel sind.“
Und das ist für manches Jahr schon eine ermutigende Erkenntnis, wenn man sagen kann: Ich bin.
Denn dazu muss man ja erst einmal ausgezogen sein auf der Suche nach diesem „Wer bin ich überhaupt?“ Und: „Was bin ich?“
Da geht dieser Hauke Meyer aus Südniedersachsen auch manchmal sehr ruppig mit sich und seinen Liebsten um. Aber seine beiden Wintergoldhähnchen scheinen ihn doch so nehmen zu wollen, wie er ist. Und wenn man so recht nachdenkt: So ein ruppiger Bursche, der auch mal dreckige Vergleiche wählt, ist einem doch irgendwie wesentlich sympathischer als all die glattgeleckten „Ich bin irgendwas“, bei denen man nicht mal auf die Idee käme, es könnten komische Vögel sein.
Eine wütende Biografie aus dem dunkelsten Leipzig
Der Albtraum einer Kindheit in einer von Alkohol und Gewalt zerfressenen “Familie”

Annett Leander: Umarme mich – aber fass’ mich bloß nicht an! Foto: Ralf Julke
Es kommt ganz unauffällig in Weiß daher. Es ist auch keine kreischende Biografie, mit der der Leipziger Einbuch-Verlag nun die Bestseller-Listen rocken will. Auch wenn es für den kleinen Leipziger Verlag wieder einer dieser mutigen Vorstöße ist, die in großen Verlagen kein Controller zulassen würde: Die Lebensgeschichte einer jungen Leipzigerin, die wütend ist, richtig wütend.
Und anfangs denkt man noch: Das geht eigentlich nicht. So ungedämpft kann man doch die Wut nicht rauslassen auf die eigenen Eltern. Aber dann nimmt die junge Autorin ihre Leser mit in eine Kindheit, wie man sie im Leipzig der 1990-er Jahre eigentlich nicht vermutet hätte, eine Kindheit mit Eltern, die schon weit vor der Geburt der Kinder sämtliche Lebenskoordinaten verloren haben, beide dem Alkohol verfallen und schon seit Jahren betreute Klienten von Sozial- und Jugendämtern. Mehrfach wurden ihnen schon Kinder entzogen – die ältesten mit schwersten Behinderungen, die möglicherweise nicht nur in Alkohol- und Tabakkonsum während der Schwangerschaft ihre Ursache haben, sondern auch in groben Misshandlungen des Mannes, den die Autorin irgendwann nur noch verächtlich den Erzeuger nennt.
Und obwohl die zuständigen Ämter um diese Karrieren wissen, handeln sie bis ins Jahr 2001 so, als könne man so eine Familie mit Ratschlägen, wechselnden Betreuern und immer wieder Hilfe in letzter Minute, wenn die Wohnungskündigung drohte, auf den richtigen Pfad führen.
Die Akte, die die Autorin letztlich einsehen kann, erzählt von einer Amtsbetreuung, die eigentlich alle Signale auf dem Tisch liegen hatte – und trotzdem nicht die richtigen Schlüsse zog. Man fühlt sich wohl zu Recht an einige dramatische Vorfälle in der jüngeren Leipziger Geschichte erinnert: Wenn Betreuer nicht einschreiten, obwohl sie um die massiven Störungen und Probleme der Eltern wissen, endet das oft genug auch mit dem Tod der Kinder.
Erst recht, wenn ein Mann wie der hier geschilderte Vater die Hauptrolle spielt, nicht nur völlig alkoholabhängig und faul, sondern auch noch ein Tyrann, wie er im Buche steht, einer, der seine Familie mit Gebrüll und Gewalt einschüchtert. Und nicht nur die eigene Frau hat er so gefügig gemacht, dass sie nicht einmal mehr ein Wort des Widerspruchs wagt. Auch die Kinder bekommen den Jähzorn und die schnell in Schläge ausartende Herrschsucht dieses Mannes zu spüren, der Monat für Monat das Geld der Familie versäuft.
Die Kinder müssen nicht nur in alten, von irgendwo spendierten Kleidungsstücken in die Schule – sie sind auch verlaust und erleben immer wieder Tage völlig ohne eine Mahlzeit. Und trotzdem schreitet niemand ein. Augenscheinlich bekommt die Lehrerin nichts mit, die Nachbarn hören wohl den täglichen Lärm aus der Wohnung. Protokolliert aber sind nur die gewalttätigen Ausfälle des Vaters gegen die Mutter, nicht die gegen die Kinder. Doch für die vergeht eigentlich kein Tag ohne Prügel. Und es kommt irgendwann auch, wie man es von Anfang an befürchtet, dass der Mann, der nicht einmal ansatzweise die Rolle des Vaters ausfüllt, sich auch sexuell an seiner Tochter vergreift.
Und das ist der Punkt, an dem man weiß: Dieses Buch ist ein ganz seltenes. Denn die Autorin schafft etwas, was die meisten Kinder, die so eine Lebenserfahrung hinter sich haben, niemals schaffen: Sie schafft es, über all das zu schreiben. Die meisten scheitern daran, verschließen es für ihr ganzes Leben in sich. Denn diese Art schwarze Pädagogik, wie sie Alice Miller nennt, formt den Charakter fürs ganze Leben und zerstört jede emotionale Basis. Sie legt die Grundlagen für Traumata, Panikattacken und Krankheiten, die die Betroffenen immer wieder in die Gefahr bringen, sich selbst zu zerstören. Ob mit Alkohol, Tabletten oder Zerstörungen des eigenen Körpers. Die früh erlebten Aggressionen durch die eigentlich wichtigsten Menschen im eigenen Kindheitserleben werden zur Aggression gegen sich selbst. Und helfen können am Ende auch nur ansatzweise lange, quälende Therapien.
Von denen die junge Autorin schon einige hinter sich hat. Doch das bewahrt sie nicht davor, unversehens von neuen Panikattacken heimgesucht zu werden. Was ihr augenscheinlich auch passierte, als der größte Teil ihrer Geschichte schon zu Papier gebracht war. Da genügte ein einzelner, nach Alkohol und Qualm stinkender Fahrgast in der Straßenbahn.
Auszüge aus der Akte des Jugendamtes am Ende des Buches erzählen von der Tragödie der Verwaltung, die mit den falschen Ansätzen über Jahre versuchte, eine Art “Rettung der Familie” zu bewerkstelligen, obwohl man über die Vernachlässigung der Kinder eigentlich Bescheid wusste.
Am Ende sind der Weg ins Heim und die Aufnahme in eine Pflegefamilie die Rettung für das Kind und auch die so wichtige Erfahrung, dass es tatsächlich Menschen gibt, die bedingungslos sorgen und lieben und Kindern Geborgenheit vermitteln können. Auch mit allen Problemen, die so eine Beziehung mit sich bringt. Denn die Aggression, die das gequälte Kind über Jahre erfahren hat, bricht sich auch in ihrer Pflegefamilie immer wieder Bahn.
Am Ende versteht man die ungebremste Wut. Da teilt man sie auch. Und man bekommt ein Gefühl dafür, wie tief verletzt Menschen ihr Leben lang sind, die so eine Kindheit erlebt haben. Und was wahrscheinlich passiert, wenn sich die jungen Erwachsenen diesen traumatischen Erfahrungen nicht stellen, sondern sie – mit den von den “Eltern” gelernten Mitteln – verdrängen.
Die Autorin hat sich gestellt – mit einem erstaunlichen Mut. Auch mit einer bestechenden Offenheit. Und eigentlich steckt auch ein Appell darin an unsere Gesellschaft, mit all der so gut geübten Schönmalerei einmal aufzuhören. Man kann solche “Familien” nicht reparieren, nicht mit Beratungen zur ewig leeren Haushaltskasse und nicht mit Tipps zur modernen Erziehung. Man kann nur die betroffenen Kinder so schnell wie möglich retten und aus diesen desolaten Verhältnissen herausholen.
Denn wenn das nicht passiert, sind es die betroffenen Kinder, die ihr Leben lang leiden. Und das erst recht da, wo andere Menschen gelernt haben zu vertrauen und sich sicher zu fühlen.
“Das Einzige, was ich für meine Erzeuger empfinde, ist Wut und Ekel”
Tanners Interview mit Annett Leander, der Autorin von “Umarme mich – aber fass´mich nicht an!”

Annett Leander schaffte es, über all das Grauen zu schreiben. Foto: privat
Manchmal zerdrückt es einem das Herz. Beim Lesen der Autobiografie von Annett Leander war das so. Kein locker-flockiger Trendroman, kein stilbezogenes Lyriken, sondern finsterste Realität. Es ging um Missbrauch jeglicher Art an Kinderseelen und ganz speziell an der Seele und an dem Körper von Annett Leander. Tanner musste da einfach noch mal nachfragen, weil viel öfter darüber geredet werden sollte.
Liebe Annett Leander. Der Chef des Einbuch Buch- und Literaturverlags Leipzig, der Patrick Zschocher, hat mir Ihr Buch “Umarme mich – aber fass´mich bloß nicht an!” auf den Tisch gelegt. Und ich habe es gelesen. Im Untertitel steht: Eine Autobiografie, die viel zu früh geschrieben werden musste. Ich verstehe schon warum sie geschrieben werden musste. Könnten Sie bitte unseren Lesern erzählen, was das Thema so dringend machte. Auto-Biografie impliziert ja, dass es Ihre Geschichte ist.
Ich habe viel zu viele Jahre meines Lebens geschwiegen. Als Kind, aus Angst abgelehnt zu werden oder nicht glaubhaft zu erscheinen, heute bin ich erwachsen und ich bin nicht mehr in der Rolle des Kindes, aus der ich nie ausbrechen konnte. Sicherlich ist mit meinem Buch mein Leben nun nicht von vorne begonnen, aber da ich es aufschreiben konnte, habe ich mir ein großes Stück Last genommen und auch alle Menschen, die es mit Interesse lesen, werden vielleicht etwas “wachgerüttelt”. Der Missbrauch und die Gewalt an Kindern ist in unserer Gesellschaft ein Tabu-Thema, keiner spricht darüber und viel zu oft wird einfach weggesehen, warum kann ich allerdings nicht verstehen. Manche Menschen können sich nicht im Geringsten vorstellen, was mit einer Kinderseele passiert, wenn sie durch Demütigungen und körperliche sowie psychische Repressalien zerstört wird! Ein Leben lang hat man damit zu kämpfen.
Missbrauch an sich ist ja nicht wirklich ein Thema – außer wenn es von politischen Rattenfängern zur Postulierung von Unmenschlichkeit benutzt wird. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Gründen und Folgen findet meines Erachtens nicht statt. Sehe ich das falsch? Sie als Betroffene haben da sicher einen besseren Einblick – bewegt sich da etwas in unseren Regionen?
Da haben Sie Recht, es wird nie wirklich darüber gesprochen. In der Politik und im Bezug auf das Gesetz habe ich immer das Gefühl, es wird wie eine Lappalie behandelt. Viel zu oft bekommen Täter eine viel zu geringe Strafe, wenn überhaupt. Eine Therapieauflage oder Bewährung? Was soll das bringen? Es wird keinen Täter daran hindern, sich ein neues Opfer zu suchen.
Wenn ich in der Lage wäre, dass mein Peiniger noch am Leben wäre und angenommen er hätte im Knast gesessen und jetzt wäre der Zeitpunkt, dass er wieder entlassen werden würde, ich würde wohl in Panik ausbrechen… Die Folgen aus so einer Erfahrung verfolgen ein Opfer wohl sein Leben lang, manchmal mehr und manchmal weniger. Aber Gründe für so eine Tat sehe ich keine! Es gibt keinen Grund einen Menschen so sehr zu “beschmutzen” und zu demütigen. Egal, ob es nun um Kinder geht oder Frauen oder Männer. So etwas tut man nicht und da nach einem Grund zu suchen ist fern ab von all meinen moralischen Werten.
Wie waren die Reaktionen auf Ihr Buch? Ganz besonders interessiert mich da natürlich Ihr persönliches Umfeld.
Die Reaktionen auf mein Buch waren eine Mischung aus Schock, Dankbarkeit, vielleicht auch etwas Mitgefühl bis hin zu Wut … Wut über die Personen, die für mein Trauma verantwortlich sind. Natürlich bin ich sehr froh, dass ich diese Reaktionen überhaupt erlangen konnte. Meine Partnerin hat mich die ganze Zeit unterstützt und mir immer wieder die Schulter zum anlehnen gegeben, wenn ich sie brauchte, wenn mir das Schreiben und die damit verbundenen Flashbacks (Trauma-Wiedererlebungen) über den Kopf gewachsen sind. Sie ist natürlich sehr erfreut darüber, dass die Reaktionen auf mein Buch positiv ausfallen.
Ihre Geschichte muss Thema in Bildungseinrichtungen sein, eigentlich auch, um die totale Einsamkeit der Opfer zu durchbrechen. Ich dachte immer, ich wäre der einzige in meiner Klasse gewesen, der dauernd geschlagen wurde. Mir hätte es geholfen zu wissen, dass ich nicht völlig alleine bin. Heute weiß ich das. Gibt es Bestrebungen Ihrerseits mit Ihrer Geschichte aktiv aufzuklären? Ins Gespräch zu kommen? Und wenn ja, welche – wenn nicht, warum nicht?
Die Idee, in Bildungseinrichtungen mit meiner Geschichte zu gehen, finde ich sehr gut. Zur Aufklärung, aber auch um beispielsweise Lehrer auf kleine Anzeichen aufmerksam machen zu können. Des Weiteren, denke ich, wäre es wichtig, im Bereich der Sozialen Berufe anknüpfen zu können und die Personen aufmerksam zu machen, die unmittelbar in einer Rolle sind, die sich auch ganz nah an einem Opfer befinden kann. Oft muss man hinter die Fassade schauen, um wirklich zu begreifen, dass ein tieferer Grund für manch Verhaltensweise da im Verborgenen liegt.
Wie leben Sie heute? Gibt es ein Verzeihen? Ihr Vater hat nie ein Wort der Entschuldigung gesagt – wie gehen Sie damit um?
Heute lebe ich mit meiner Partnerin Sarah in einer eigenen kleinen Wohnung. Wir sind seit Februar 2012 ein Paar, auch wenn es eine Menge Unfrieden gab, haben wir uns immer wieder zusammenfinden können. Zurzeit hole ich mein Abitur nach, um im Nachhinein mal studieren zu können. Gern würde ich irgendwann im Bereich der Palliativpflege oder im Bereich Lehramt an einer Berufsschule arbeiten.
Ein Verzeihen gibt es nicht und auch habe ich wenig Interesse daran zu wissen, warum mein Erzeuger diese Dinge getan hat. Wenn ich an ihm denke und sein Gesicht in Form eines Bildes in meinen Kopf schießt, muss ich mich beherrschen, um noch klar denken zu können. Das Einzige, was ich für meine Erzeuger empfinde, ist Wut und Ekel.
Ich selber brauchte lange, um zu verstehen, dass ich nicht schlecht bin. Wie ist Ihre ganz persönliche Selbstsicht heute? Haben Sie Wege aus der Programmierung gefunden oder suchen Sie noch?
Es ist mir noch nicht gelungen, selbst aus meinem Innersten heraus sagen zu können, dass ich selbst etwas wert bin oder dass ich gut bin, so wie ich bin. Vielleicht kann ich das aber irgendwann, ich arbeite daran.
Ich wünsche Ihnen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit, liebe Annett Leander. So wie Sie sind, sind Sie gut.
Vielen Dank.
Wenn die Urenkelin die Lebensgeschichte ihrer Uroma erzählt: Mama Luise
Man hat es doch glatt verpasst …
So erzählt Katja Lenßen zwar stellvertretend für ihre Urgroßmutter deren Geschichte, erschafft aber wohl auch mit viel Liebe zu ihrer Heldin eine dichte, atmosphärische Lebensgeschichte, die auch nicht 1947 endet, als die kleine Familie wieder beisammen ist, sondern weiterläuft bis 1982, bis zum Tod Luises. Man erfährt, wie die Heldin und ihre kleine Familie, nachdem sie alles verloren haben, mit ostpreußischer Beharrlichkeit ihr neues Leben anpacken und sich eine neue Existenz aufbauen, aus dem Vorgefundenen das Beste machen und natürlich auch zutiefst erschüttert sind, wenn das Tragische wieder eingreift in ihr Leben.
Das sind die eigentlichen Romane, die Bestand haben werden, gerade dann, wenn ihre Hauptfiguren so lebendig werden wie Luise in Katja Lenßen geglücktem Versuch, die irgendwie immer offen gebliebene Familiengeschichte nun einmal wie eine große, herzliche Parabel auf das Leben zu erzählen. Ihre eigene Geschichte – die Begegnung als Baby mit der Urgroßmutter im Krankenbett – gehört dazu. Und am Ende weiß sie dann auch, warum die Geschichte immer noch rumorte im Familienkreis. Jetzt wird sie auf andere Weise weitergegeben – als Buch, eines der wichtigsten und emotionalsten im Programm des Einbuch-Verlages.
Der Bundesrepublikpalast: Die wehmütigen Erinnerungen eines abgerissenen Hauses
 Tino Schreiber: Der Bundesrepublikpalast.
Tino Schreiber: Der Bundesrepublikpalast.
Man suchte dann eifrig nach einer neuen Mehrzwecknutzung, die sehr zum Erstaunen Tino Schreibers doch tatsächlich in Vielem der Mehrzwecknutzung des Palastes der Republik als Tagungs-, Kongress- und Kulturhaus ähnelte. Ergebnis war ein “Humboldt-Forum”, das die Kubatur des alten Preußenschlosses aufnimmt, aber nur drei Straßenfronten und den einstigen Schlüterhof rekonstruiert, die Schauseite zur Spree wird modern nachempfunden, das Innenleben des Bauwerks wird sowieso komplett modern.
Im Juni 2013 legte Bundespräsident Joachim Gauck den Grundstein für den Neubau, der nun wohl mindestens 670 Millionen Euro kosten wird. 590 Millionen Euro stellt der Bund zur Verfügung, 80 Millionen Euro für die Fassadenrekonstruktion sollen durch Spendengelder gesammelt werden. Ursprünglich sollte schon 2011 Baubeginn sein, jetzt geht es wohl 2014 los. Aber wie gesagt – es ist ein amtliches Großprojekt. Da werden einige Leute gespannt sein, wie sich die Kosten entwickeln.
Vieles von dem erzählt Tino Schreiber freilich nicht. Zu tief sitzt in ihm die Verletzung über den Abriss des Palastes der Republik, der für seine Zeit und DDR-Verhältnisse sowieso natürlich ein kleines technisches Wunderwerk war. Nach einer Auseinandersetzung mit der Fehde Palast vs. Schloss taucht Tino Schreiber in die knapp 30 Jahre Geschichte des Bauwerks ein, erzählt von den Bauarbeiten und den Einweihungsfesten, von den Parteitagen und Volkskammersitzungen, den Theateraufführungen und den Aufsehen erregenden Konzerten im Palast. Zumindest aus (Ost-)Berliner Sicht muss der Bau tatsächlich eine große Attraktion gewesen sein. Vielleicht sieht man die Sache aus dieser Perspektive ein bisschen anders als etwa aus sächsischer Perspektive, denn die Ressourcen, die hier freigiebig verbaut wurden, fehlten logischerweise andernorts.
Schreibers Position ist durch die gewählte Hauptperson natürlich deutlich. Das Wort Autobiographie trifft es wohl am besten, Polemik oder Streitschrift wäre auch nicht ganz falsch. Ein Roman ist es wirklich nicht. Dazu hätte es einiger handelnder Protagonisten und eigenständiger Handlungsstränge mehr bedurft. Aber für alle, die gern nachlesen wollen, wie emotional die Debatte um den Palast und seine Entfernung geführt wurde, ist Schreibers Buch natürlich eine aufwühlende Lektüre. Fast möchte man gleich selbst ein Transparent malen und losrennen und irgendwie dafür oder dagegen protestieren.
Aber das wird wohl nichts nützen. Wenn sich ein paar Staatssekretäre erst einmal in den Kopf gesetzt haben, dass etwas weg muss, dann kommt es auch weg. Die demokratischen Beschlüsse dafür organisiert man sich schon. Und wenn man Geld braucht für einen neuen Protzbau, dann findet sich auch das – und wenn man dafür Schulden aufnehmen oder die Steuern erhöhen muss. Da ähneln sich politische Sachwalter irgendwie immer. Ob das neue Schloss, das dann nur noch von außen so aussehen soll, seinen Zweck erfüllt und Berlins historische Mitte wieder bereichert, ist dann eine ganz andere Frage. Die gewählte Dimension des Bauwerks spricht eigentlich dagegen. Aber so ist das ja meistens mit Großprojekten.
Lausbubengeschichten aus der Lausitz: Die Karasekbande
 Klaus Singwitz: Die Karasekbande.
Klaus Singwitz: Die Karasekbande.
Man spürt beim Lesen die Freude des nunmehr keineswegs mehr lockenköpfigen Klaus, seine Lausbubenabenteuer für die Enkel aufzuschreiben. Doch wie das mit liebevoll erzählten Lausbubengeschichten so ist: Viele einstige und neuere Lausbuben werden sich darin wiedererkennen, gerade auch, weil Klaus ein bisschen so ist wie alle – manchmal auch schrecklich naiv und blauäugig. Das ein oder andere Abenteuer hätte auch ganz anders ausgehen können.
Und manchmal fühlt man natürlich mit, in was für eine peinliche Situation sich der kleine Möchtegern-Räuber da nun wieder hinein geritten hat. Und es dürfte auch so manchen heutigen Enkel in pure Aufregung versetzen, wenn es um die Lösung geht: Wie kommt er da nur wieder heraus? – In anderen Kinderbüchern setzt es nach solchen Streichen eine ordentliche Tracht Prügel. Und der Vater von Klaus hat so etwas wohl noch erlebt. Aber der Lehrer Richter, der für Klaus so eine wichtige Rolle spielt, steht auch für einen Umbruch der Erziehung in Deutschland, der im Osten einige Jahre früher stattfand als im Westen.
Ein echtes Lausbubenbuch, das die Zeit, in der die Geschichten handeln, sehr einfühlsam aus der Perspektive des kleinen Räubers erzählt, den auch der große Opa im fernen Norwegen nicht verleugnen möchte. Im Gegenteil. Die Großväter müssen ihre Geschichten weitergeben, findet er. Auch weil beide was draus lernen können – die neuen Lausbuben und die alten.
Was braucht der Mensch auf Erden? – Bernhard Künzner versucht’s mal in 30 Minuten …
So ungefähr zwei, drei Tage, auch wenn er sein Buch in lauter Minuten-Kapitelchen packt. Der Beginn ist ein Gedankenexperiment: Wie fühlt man sich, wenn man völlig nackt an einem leeren Sandstrand irgendwo weit weg von der Zivilisation landet? Wie fühlt sich das an in den ersten Minuten und dann ein bisschen später, wenn man gemerkt hat, dass man sich an so einem Strand nicht wirklich Gedanken um den Terminkalender des nächsten Tages machen muss? Aber natürlich merkt man da schon, wie tief unser durchorganisierter Alltag in uns sitzt, eng verwoben mit der permanenten Angst, Termine zu verpassen, Aufgaben zu vermasseln, den “Chefs” nicht zu genügen. Manche sind ja geradezu gehetzt von diesen Ängsten. Und ihre “Chefs” tun alles dafür, dass diese Angst nicht nachlässt.
Auch deshalb fahren viele Familien lieber in ein durchorganisiertes Hotel-Ressort als an einen einsamen Strand am Atlantik. Man ahnt schon, was passieren könnte.
Vitamin B 17: Eine andere Krebstherapie – aber auch ein paar Gedanken über das eigentliche Problem